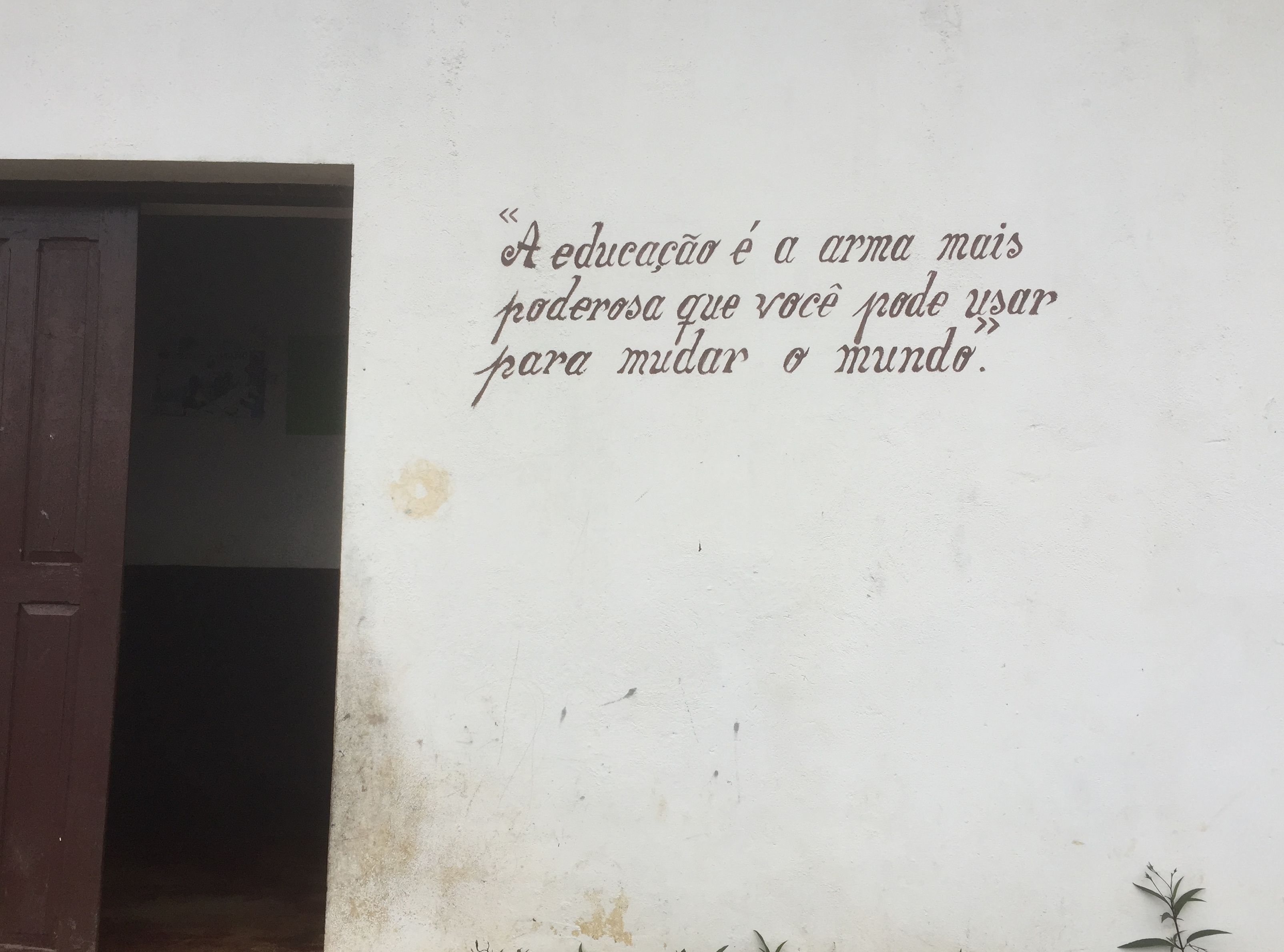Der Bildungsauftrag öffentlich-rechtlicher Medien

Eine Studie im Auftrag des Public-Value-Kompetenzzentrums des ORF
Dr. Volker Grassmuck
erschienen in:
ORF, Public Value Jahresstudie 2016/17 „Der Auftrag: Bildung im digitalen Zeitalter“, Wien 2017, S. 91-222
korrigierte, ergänzte und verlinkte Version
19.11.2017
In der intensiven Debatte über den künftigen Auftrag öffentlich-rechtlicher Medien spielt der Bildungsauftrag erstaunlicherweise fast keine Rolle. Die Studie beginnt mit einem kurzen Überblick über die Definitionen des Bildungsauftrags öffentlich-rechtlicher Medien in Großbritannien, Deutschland und Österreich mit dem Ziel, in dem wenig konturierten Feld zumindest Parameter eines öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrages zu identifizieren.
Die Meinungs- und Willensbildung des demokratischen Souveräns mit vielfältigen Angeboten zu unterstützen, ist Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Daher ist auch für seinen spezifischeren Bildungsauftrag die politische Bildung als eine zentrale Aufgabe zu erwarten, die jedoch in der Literatur selten expliziert wird (z. B. von Naderhirn 2009). Zum einen gibt es Bildungsangebote im engen Sinne für den Vorschulbereich, für Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung rsp. lebenslanges Lernen, mit denen die Öffentlich-Rechtlichen die primären Bildungsträger unterstützen und ihr Curriculum begleiten. Daneben verstehen sie ihren Bildungsauftrag in einem weiten Sinne als eine programmliche Querschnittsaufgabe. Es finden sich Hinweise auf die enge Verwandtschaft mit dem Kulturauftrag (Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 2006), aber auch mit dem Informationsauftrag (Hoffmann 2016).
Nach der Darstellung des regulatorischen und programmlichen Ist-Zustands wird im nächsten Schritt auf die Debatte über die Weiterentwicklung des Auftrags im digitalen Zeitalter fokussiert. Der digitale Medienwandel stellt Grundkategorien des Rundfunksystems in Frage („Rundfunk“, linear vs. non-linear usw.) und fordert Redaktionen mit neuen Aufgaben (cross-mediale Multi-Plattform-Verbreitung, Moderation von Kommentaren usw.).
Ein bereits vor der Digitalisierung einsetzendes, aber durch diese eskalierendes Problem ist der Generationenabriss. Heute liegt der Altersdurchschnitt für BBC One bei 61 Jahren, für BBC Two bei 62 (Guardian 29.03.2017). Zum ORF lassen sich keine öffentlichen Zahlen finden. Das Durchschnittsalter des deutschen Fernsehpublikums lag 2016 bei 53 Jahren, das des Ersten bei 60 Jahren. Unter den 14- bis 49-Jährigen erreicht das Erste nur noch acht Prozent (ARD 2016: 52). Entsprechend existentiell stellt sich die Herausforderung für die ARD dar:
„Es ist und bleibt eine der wichtigsten strategischen Herausforderungen des Ersten, den Fortbestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf Dauer durch eine verbesserte Ansprache jüngerer Zielgruppen abzusichern.“ (ebd.).
Die digitale Medienumwelt bringt neue Herausforderungen hervor: algorithmisch verstärkte Echokammern oder Filterblasen, sozialen Bots, psychographisches Targeting, Künstliche Intelligenz ebenso wie die Reaktionen von Informationsvermeidern oder umgekehrt Sozialvermeidern wie Otaku und Hikikomori.
Die Umwelt, in die die Öffentlich-Rechtlichen sich begeben müssen, ist somit turbulent. Zugleich erfolgt dieser Schritt in einer Zeit, die von „Autoritätsverlust der Medien“ (Wolf 2015), einer Erosion der politischen Kultur und des politischen Wissens, einer „Postfaktizität“, in der gefühlte Wahrheiten wichtiger sind als Tatsachen, und einer Empörungsbewirtschaftung durch populistische Strömungen gekennzeichnet ist.
In dieser Krise der Öffentlichkeit halten sich nach allen empirischen Erkenntnissen öffentlich-rechtliche Medien (ÖRM) als „Vertrauensanker“, Leitmedien und Rückgrat der europäischen Qualitätsmedienproduktion wacker. Zugleich werden sie aus verschiedenen Richtungen in ihrer öffentlichen Finanzierung bis hin zu ihrer grundsätzlichen Daseinsberechtigung in Frage gestellt.
Dass in dieser Lage dem Bildungsauftrag neben Information, Beratung und Kultur eine überragende Rolle zukommt, scheint offenkundig. Doch wie können Bildungsziele mediumsadäquat im interaktiven und plattformorientierten Internet verwirklicht werden? Welche Problem- und Gefährdungslagen werden von den verschiedenen Akteuren genannt und welche Vorschläge für den Bildungsauftrag im digitalen Zeitalter werden formuliert? Wie können insbesondere Bildungsinhalte breit zugänglich gemacht und vorgehalten sowie für die gesellschaftliche Weiternutzung bereitgestellt werden? Welche rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sind zur Erfüllung eines mediumsadäquaten Bildungsauftrages notwendig?
Besonderes Augenmerk gilt den für die zentralen Fragen avanciertesten Projekten des öffentlichen Rundfunks in Europa, darunter den Plattformplänen der BBC und dem ausschließlich im Internet verbreiteten Angebot für 14- bis 29-Jährige namens „Funk.net“ von ARD und ZDF. Beide haben bereits in ihrer Planung und rundfunkrechtlichen Konzipierung Fragen über die weitere Ausgestaltung des öffentlichen Medienauftrags aufgeworfen und werden nach ihrem Start von vielen Beobachtern als Pfadbahner gesehen in eine Richtung, in die öffentlich-rechtliche Angebote sich generell öffnen müssen.
Inhalt
Der öffentlich-rechtliche Auftrag

Der Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrags ist es, vielfältige und qualitativ hochwertige, journalistisch-redaktionelle Angebote für die individuelle und kollektive Bildung von Meinung, Urteil und Willen bereitzustellen. Diese Angebote sollen die Form von Information, Bildung, Unterhaltung annehmen, der Aufgaben-Trias, die der BBC-Gründungsdirektor John Reith kanonisiert hat, und der meist Kultur, teils auch Beratung hinzugefügt wird.
Die Europäische Union hat in ihrem Gründungsdokument, dem EU-Vertrag (EUV) von 1992, staatliche Beihilfen an Unternehmen grundsätzlich für unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt (Artikel 92 EGV 1992, aktuell Artikel 107 EUV (Web, Epub)). Davon gibt es eine Reihe von Ausnahmen, darunter eine nachträglich eingefügte, die die Förderung von Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes zulässt, „soweit sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.“ Keine jedoch für Medien. Rundfunkbeiträge gelten europarechtlich, obgleich sie keine Steuern sind, als staatliche Beihilfen an Unternehmen.1
Dazu wurde eine Ausnahme erst nachträglich eingeführt, als 1997 der EUV durch den Vertrag von Amsterdam novelliert und ihm das Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten (EU 1997: 109) angehängt wurde. Es geht aus von der Erwägung, „dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren“. Europarechtlich ist somit Bildung im Interesse der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft als Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anerkannt.
Darüber besteht weitgehende Einigkeit. Alles weitere ist im Fluss, in Frage gestellt durch den Medienwandel, umstritten durch Gegner öffentlich-rechtlicher Medien. Zudem ist der Bildungsauftrag kaum näher definiert, und es liegen angesichts seiner zentralen Bedeutung kaum empirische Erkenntnisse über seine Erfüllung und über die Wirkungen öffentlich-rechtlicher medialer Bildung vor.
Bildung gehört nach Anspruch und Praxis von Beginn an zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ein regelmäßiges Schulfernsehen z. B. gab es seit den 1960er Jahren in den meisten europäischen Ländern. Der Bildungs-, gelegentlich auch Erziehungsauftrag wird von den Anstalten einerseits in einem engen Sinne als curriculumsbegleitendes Angebot für Schule und Hochschule, andererseits in einem weiten Sinne als Allgemeinbildung, staatsbürgerliche Bildung, bildungsbürgerlicher Hochkulturkanon verstanden. Während der Bildungsauftrag im ersten Sinne durch die Curricula der staatlichen Bildungsträger klar strukturiert wird, ist er im zweiten informellen Sinne schwieriger zu fassen und kaum in konkrete Programm-Postulate zu gießen. Dieser überschneidet sich mit dem Informationsauftrag, aber auch mit Beratung und Unterhaltung (z. B. der Medien- und Kulturwissenschaftler Lothar Mikos (2008: 30) zu „Bildung durch Unterhaltung“). Am engsten erscheint jedoch die Verbindung von Bildung und Kultur.
„Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland … seinen Kultur- und Bildungsauftrag im Wesentlichen erfüllt, daran wurde eigentlich nie ernsthaft gezweifelt,“ sagte der frühere Leiter der Medienforschung des WDR, Josef Eckhardt, in einem Vortrag zur Erfüllung des Kulturauftrags im Januar 2005. Und er fügte hinzu: „Es besteht allerdings kein umfassender Konsens darüber, worin die Erfüllung dieses Auftrags besteht.“ (Eckhardt 2005: 4)
Eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages von 2006 zum Kultur- und Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanstalten sagt einiges über Kultur, aber nichts über Bildung. Sie verweist auf die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ vom April 2005, die ergeben habe, dass die Definition des Kultur- und Bildungsauftrages und die Frage, wie der Rundfunk diesen Aufträgen nachzukommen habe, weitgehend ungeklärt scheine (Wissenschaftlicher Dienst 2006: 4). Auch der Kulturbegriff im Rundfunkrecht sei unscharf, solle jedoch in den Leitlinien und Selbstverpflichtungen der Rundfunkanstalten konkretisiert werden. In diesen findet sich bei ARD, ZDF und Deutschlandradio Kultur als Kernaufgabe. Während die ARD Kultur als eigene Kategorie in ihrem Fernsehprogramm ausweist, mit den Unterkategorien Kunst, Wissenschaft, Geschichte/Zeitgeschichte, begreift das ZDF Kultur übergreifend als „Leit- und Querschnittsprinzip“. Die Ausarbeitung schließt: „Dies zeigt, dass, so wenig sich die Öffentlichkeit darüber einig ist, wie Kultur definiert werden soll, so wenig existiert auch ein senderübergreifender Konsens darüber, welche Sendungen unter die Sparte Kultur fallen.“ (ebd.: 13)
Für die Schweiz leiten Bonfadelli et al. ihren Forschungsbericht Öffentlicher Rundfunk und Bildung. Angebot, Nutzung und Funktionen von Kinderprogrammen von 2007 im Auftrag des Bundesamtes für Kommunikation mit dieser Lagebeschreibung ein: „Obwohl Bildung speziell im Kinderprogramm des Fernsehens seit den frühen 1960er Jahren im öffentlichen Diskurs ständig präsent war und kontrovers diskutiert worden ist, gibt es praktisch kein wissenschaftlich gesichertes Wissen über den Problembereich Rundfunk und Bildung in der Schweiz bzw. über das Bildungsangebot in den Programmen der SRG.“ (Bonfadelli et al. 2007: 7)
Herausforderungen
Öffentlich-rechtliche Medien (ÖRM) stehen vor einer Reihe von Herausforderungen. So wird ihre Daseinsberechtigung in der Medienlandschaft des 21. Jahrhunderts aus verschiedenen Richtungen grundsätzlich in Frage gestellt, vor allem im Online-Bereich, oft gekoppelt mit den Kosten für die Beitragszahler. Kommerzielle Rundfunkanbieter (in UK mit Independent Television (ITV) seit 1955, in DE seit 1987, in AT seit 1997) und Presseverlage gehen regelmäßig gegen die Öffentlich-Rechtlichen vor. Internet-native Medien sind im Wettbewerb um Aufmerksamkeit hinzugekommen. Der Medienwandel führt zu einer Überalterung des öffentlich-rechtlichen Publikums und – eng damit verbunden – der Notwendigkeit, sich zu digitalisieren. Neben spezifischen Herausforderungen stehen Öffentlich-Rechtliche auch vor gesellschaftlichen Veränderungen der Öffentlichkeit und der Meinungsbildung, vor allem durch Soziale Medien. Diese sollen im Folgenden kurz skizziert werden. Dabei steht die Untersuchung selbst vor der Herausforderung, einen Bildungsauftrag zu konturieren, der trotz jahrzehntelanger Praxis kaum definiert und erforscht ist, sich dem Wandel der Medienlandschaft und der Nutzungsweisen anpassen muss und doch so zentral in der Begründungsrhetorik öffentlich-rechtlicher Medien steht.
Verjüngung des Publikums
Die demographische Entwicklung lässt erwarten, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit der Alterskohorte der heute 60-Jährigen aussterben wird. Der „Generationenabriss“ setzt schon mit Beginn des dualen Systems ein, als das junge Publikum zu den neuen privaten Sendern abwanderte. Ab Mitte der 1990er Jahre zieht das Internet weitere Aufmerksamkeit von den Öffentlich-Rechtlichen ab. Mediennutzung prägt sich in der Jugend. Wer mit dem Internet aufwächst, wird kaum später im Leben zum Fernsehen wechseln.
Heute liegt der Altersdurchschnitt für BBC One bei 61 Jahren, für BBC Two bei 62 (Guardian 29.03.2017), für ARD Das Erste bei 61 Jahren (Programmauftrag der ARD 19.10.2015). Hinweise wie der, dass die Nachrichten ZiB20 eine Altersdurchschnitt von 42 Jahren haben und damit „ein außergewöhnlich junges Publikum“ (Presse 19.02.2013), lassen darauf schließen, dass es auch beim ORF nicht anders ist.
Im Radio wurde schnell darauf reagiert. In Deutschland ging schon 1987 mit Radio Bremen 4 der erste Hörfunkkanal für Jugendliche auf Sendung, bis nach und nach alle Länderanstalten ihre Jugendwellen betrieben. Beim ORF liegt der Schwerpunkt der Bildungsangebote auf Radio Ö1. Dazu gehören das 1984 gestartete Ö1Radiokolleg und das auf einen Vorläufer auf Mittelwelle seit 1997 zurückgehende Ö1 Campus. An eine junge Zielgruppe richtet sich ferner der 1995 gestartete ORF-Jugendkulturradiosender FM4.
Im Fernsehen gab es einzelne Jugendsendungen sowie Schulfernsehen schon seit den 1960er Jahren, doch bis zu eigenen Kanälen mit jungem Schwerpunkt dauerte es bis in die Nullerjahre. In UK startete 2003 BBC Three, das sich an 16- bis 34-Jährige richtet. Im Februar 2016 war es der erste öffentlich-rechtliche Fernsehsender, der zugunsten eines reinen Online-Angebots eingestellt wurde. In Deutschland ist der Generationenabriss ab 2005 Dauerthema in den Anstalten (z. B. Giersch 2008). 2009 wurde ZDFneo gegründet, das sich an die 25- bis 49-Jährigen richtet. Auch das 2011 aus dem ZDFtheaterkanal entstandene ZDFkultur enthielt Spezialangebote für ein jüngeres Publikum. Auch EinsPlus unter Federführung des SWR wurde 2012 auf 14- bis 30-Jährige ausgerichtet. Seit 2012 lief die Diskussion über ein gemeinsames, ursprünglich trimediales Jugendangebot von ARD und ZDF. Ende 2014 schließlich beauftragte die Politik ARD und ZDF mit einem jungen Angebot ausschließlich im Internet. Das startete im Oktober 2016 unter dem Namen „Funk“. Dafür wurden die beiden TV-Kanäle ZDFkultur und EinsPlus eingestellt.
Anfangs und bis in die Nullerjahre hinein wurden Verjüngung des Publikums und Digitalisierung als getrennte Problemfelder diskutiert. Spätestens mit der Entscheidung, BBC Three ausschließlich im Internet fortzuführen, und mit der Entscheidung des deutschen Rundfunkgesetzgebers, das auch das junge Angebot von ARD und ZDF ausschließlich im Internet stattfinden solle, ist deutlich geworden, dass die beiden Themen zusammengehören.
Neuland Internet
„Fernsehen ist Monolog, Internet ist Dialog.“
(Markus Hündgen, European Web Video Academy)
Mitte der 1990er trat das Internet als Konkurrent um die Aufmerksamkeit der jüngeren Publika hinzu. Zehn Jahre später setzte die Webvideo-Revolution ein, vor allem mit dem 2005 gegründeten und 2006 von Google gekauften Youtube.
Das Internet ist mit der militärischen Vorgabe entwickelt worden, dass es auch bei Ausfall zentraler Knoten weiter funktionstüchtig bleibt. Daher ist es von Dezentralität, Verwendung sämtlicher physikalischer Signalstrecken und Redundanz der Leitungen charakterisiert. Anders als die Zentrum-an-alle-Struktur des Rundfunks verschaltete das Internet seine Teilnehmer bidirektional Punkt-zu-Punkt: Jeder angeschlossene Knoten verfügt über eine Adresse, von der aus er senden und empfangen kann. Damit erlaubt es Formen der Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation.
Gibt es Rundfunk im Internet? Nach dem Vorgesagten ist klar: nur als Sonderfall. So wurde ab 1992 ein virtuelles Punkt-zu-Multipunkt-Netzwerk namens „multicast backbone“ (Mbone) ins Internet eingezogen, dass die zeitgleiche Übertragung von Video-Daten an eine große Zahl von Empfänger ermöglichte. Es handelte sich um ein experimentelles Testbett, das sich bald bis nach Russland und in die Antarktis erstreckte. IP multicast benötigte spezielle Hard- und Software, die Tunnel zwischen den Knoten errichtete, durch die Multicast-Pakete in Unicast-Paketen eingekapselt verschickt wurden. Statt einen Datenstrom von einem Server an jeden einzelnen Empfänger zu senden, verzweigte der Mbone die Datenströme erst regional oder lokal und senkte so die Netzlast erheblich. Im November 1994 wurde ein Konzert der Rolling Stones auf dem Mbone live übertragen (NYT 22.11.1994). Heute haben dezentrale Content Delivery Networks und Cloud-Dienste die Aufgabe übernommen, Live-Video-Signale an eine große Zahl von Empfängern zu verteilen, aber auch sie machen deutlich, dass das Internet kein Rundfunk ist, mit zusätzlichen Mitteln aber einen „virtuellen Rundfunk“ annähern kann.
Ist das Internet Rundfunk? Die aus Sicht des Internet absurde Frage ist rundfunkrechtlich mit ‘Ja’ beantwortet worden. Die deutschen Verfassungsrechtler Hans-Jürgen Papier und Meinhard Schröder hatten sich 2010 im Auftrag der Konferenz der Gremienvorsitzenden der ARD mit dem Begriff der „Presseähnlichkeit“ auseinanderzusetzen, die den Öffentlich-Rechtlichen in ihren nicht sendungsbezogenen Online-Angeboten im Rundfunkstaatsvertrag untersagt ist. In ihrem Gutachten definieren Papier und Schröder Rundfunk i.S.v. Art. 5 Grundgesetz als fernmeldetechnische, „drahtlose oder drahtgebundene Übermittlung von Gedankeninhalten durch physikalische Wellen“, in Abgrenzung zur Presse, die ein körperliches Trägermedium und seine Vervielfältigung verlangt. „Zudem muss sich der Rundfunk an eine unbestimmte Vielzahl von Personen richten“, in Abgrenzung zur Individualkommunikation. Die Darbietungsform ist verfassungsrechtlich unbeachtlich, da auch Videotext, Video-, Ton- und Text-Dienste auf Abruf sowie elektronische Programmführer (EPG) bereits dem Rundfunk zugeordnete worden sind. Einfachrechtlich werde hingegen unterschieden zwischen Rundfunk als zum zeitgleichen Empfang bestimmtes lineares Programm entlang eines Sendeplans und Telemedien als elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, die nicht Individualkommunikation oder Rundfunk sind. Inhaltliche Anforderungen über eine allgemeine redaktionelle Gestaltung hinaus sah das Gutachten keine, da auch Teleshopping zum Rundfunk zähle (Papier/Schröder 2010: 7f.). Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat darüber hinaus eine spezifische Aufgabe in Form der Gemeinwohlorientiertheit im Grundversorgungsauftrag (ebd.: 12).
Da auch im Internet Texte, Bilder, Töne etc. mittels physikalischer Wellen übertragen werden, ergebe sich daraus, so Papier und Schröder, dass Internet-Angebote „grundsätzlich als Rundfunk zu qualifizieren sind, immer vorausgesetzt, dass sie die Kriterien der Adressierung an die Allgemeinheit im genannten Sinne und einer redaktionellen Gestaltung erfüllen.“ (ebd.: 18) Presse könne man nicht von Rundfunk abgrenzen, wenn man auf das Kriterium des vervielfältigten körperlichen Trägermediums, die Zeitung, verzichten würde. „Demnach wäre eine zusätzlich zum Standardprodukt verbreitete Faksimilezeitung [im Netz] noch als Presse zu qualifizieren, nicht aber ein Online-Angebot, das eigenständig redaktionell gestaltet ist.“ (ebd.: 19). Daraus folgt der berühmte Satz: „Im Internet konkurrieren Verlage mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf dem Gebiet des Rundfunks.“ (ebd.)
Die Öffentlich-Rechtlichen dürfen nicht nur im Internet aktiv werden, angesichts der wachsenden Bedeutung der Meinungsbildung im Netz – besonders „für die jüngere Generation, die vielfach das Internet als alleinige Informationsquelle nutzt“ (ebd.: 13) – müssen sie es. Papier und Schröder konstatieren einen „spezifischen Internet-Grundversorgungsauftrag“, der darin bestehe, mit ihren Online-Angeboten eine „objektive, binnenplurale Informationsquelle“ darzustellen. Gerade aus der unüberschaubaren Vielfalt von Medien im Netz erwachse „ein neues Bedürfnis des Bürgers nach Orientierung. … Gerade hier kann der Empfänger aber nicht erkennen, welche Berichte neutral sind und welche tendenziös. Insbesondere im Hinblick auf werbefinanzierte Angebote gibt es Studien, die die redaktionelle Unabhängigkeit angesichts der Absicht, möglichst hohe ‘Klickraten’ zu erzielen, bezweifeln lassen.“ (ebd.: 15)
Bei der Erfüllung ihrer Grundversorgungsaufgabe im Internet sind die Öffentlich-Rechtlichen auch keineswegs auf die klassischen Formate des Rundfunks, Ton und Bewegtbild, limitiert. Vielmehr beinhalte die vom Bundesverfassungsgericht etablierte Entwicklungsoffenheit die Auftragserfüllung „im Internet mit den im Internet üblichen Mitteln. [Sie] dürfen sich der im Internet gängigen Präsentationstechniken (derzeit vornehmlich Text, Standbilder, Verknüpfungen) bedienen.“ (ebd.: 16) Die Bedeutung der „internetbasierten Meinungsbildung“ der Öffentlichkeit und des Einzelnen ist
„mittlerweile so überragend, dass ein objektives und binnenplurales Angebot der öffentlich-rechtlichen Anbieter in diesem Bereich zum Kern der verfassungsrechtlich gebotenen Grundversorgung zu zählen ist. Daher wird man feststellen können, dass eine umfassende Internet-Berichterstattung mittlerweile zu den verfassungsrechtlich gebotenen Mindestaufgaben der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehört und daher ihre Kodifikation im RStV von Verfassungs wegen geboten war.“ (Papier/Schröder 2010: 25 f.)
Internet-Nutzung
In der Tat wachsen Verbreitung und Nutzungsintensität des Internet weiterhin stark, vor allem durch die Überall-Nutzung auf Smartphones und Tablets. Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 ergab, dass die Zahl der Onlinenutzerinnen und -nutzer in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 3,4% auf 83,8% Prozent der Bevölkerung gewachsen ist. Die 14- bis 29-Jährigen sind schon seit 2010 vollständig online, 2016 zu 91,5% täglich. Die Nutzungsdauer des Internet hat um 20 Minuten zugenommen und erstmals die Marke von zwei Stunden täglich überschritten (128 Min.). Die 14- bis 29-Jährigen kamen mit 245 Minuten (+32 Minuten gegenüber 2015) auf die doppelte Zeit. Das wichtigste Gerät für den Zugang ist das Smartphone (von 66% der Bevölkerung genutzt, mit einem Zuwachs von 14%) gefolgt von Laptop (57%) und stationärem PC (44%). Smartphone- und Tablet-Nutzer sind am längsten im Internet (ARD/ZDF-Onlinestudie 2016: Kernergebnisse).
Den größten Teil der Online-Zeit nimmt Kommunikation per E-Mail, Chat oder in Apps in Anspruch (39% der täglichen Nutzungszeit im Bevölkerungsmittel, 41% unter den 14- bis 29-Jährigen). Weiters wird Zeit für Spielen (14%) und Transaktionen wie Onlinebanking und Einkaufen (6%) verwendet. Für die Meinungsbildung am relevantesten sind die Mediennutzung (24% der täglichen Online-Zeit gesamt, 29% unter 14- bis 29-Jährigen) und die Informationssuche im Internet (17%, 13% unter 14- bis 29-Jährigen) (ebd.).
Bewegtbild im Internet hat noch einmal überdurchschnittlich zugelegt. 67% der deutschen Onliner/innen ab 14 Jahren schauten es mindestens einmal wöchentlich (+14%). Bei den 14- bis 29-Jährigen waren es 95%. Über die Hälfte in dieser Altersgruppe schaut täglich Videos auf Portalen wie Youtube. Der Anstieg betraf jedoch alle soziodemografischen Gruppen, vor allem die 30- bis 49-Jährigen (+21%-Punkte auf 71%) und die 50- bis 69-Jährigen (+15%-Punkte auf 50%) (Koch/Frees 2016). Erste Adresse für bewegte Bilder sind weiter Youtube und andere Videoportale, die von 59% der Gesamtbevölkerung und 94% der 14- bis 29-Jährigen zumindest selten genutzt werden. Auch kostenpflichtige Videoanbieter wie Amazon Prime, Netflix, iTunes und Maxdome haben zugelegt auf 18% mindestens seltene Nutzung unter der Gesamtbevölkerung (Kupferschmitt 2016).
Schließlich ist auch Facebook zu einer wichtigen Videoquelle geworden. Die Nutzung von Onlinecommunities allgemein hat weiter zugenommen, allen voran Facebook mit +7% auf 41% mindestens wöchentliche Nutzung unter allen Onlinern. Große Zuwächse sah es in den älteren Gruppen, aber auch unter den 14- bis 29-Jährigen legte Facebook um 4% zu auf 49% tägliche Nutzung. Videos auf Facebook wurden 2016 von 10% der Gesamtbevölkerung täglich genutzt (ebd.).
Webvideo steht deutlich vor Fernsehinhalten. Die Mediatheken der Fernsehsender wurden 2016 von 37% der Bevölkerung zumindest selten, aber nur von 1% täglich genutzt. Dabei liegen die Angebote von ZDF (32% zumindest selten) und ARD (31%) deutlich vor denen der Privaten (ProSieben: 21%, RTL und Sat.1 je 18%). Kupferschmitt schreibt in seiner Analyse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2016: „Warum die privaten Anbieter trotz ihres vergleichsweise jungen und damit internetaffinen Publikums im Netz hinter den öffentlich-rechtlichen Anbietern zurückbleiben, bliebe zu untersuchen.“ Als möglichen Grund sieht er den höheren Anteil an fiktionalen Kaufprogrammen, die online häufig nicht oder nur kostenpflichtig angeboten werden können, und die Kostenpflichtigkeit von Apps wie TV Now der Mediengruppe RTL (Kupferschmitt 2016: 254).
Angesichts der Vielzahl der Angebote und ihrer Bekanntheit verwundert die Forscher, dass die Online-Sehdauer sehr gering war und noch abgenommen hat. So verwende die Gesamtbevölkerung von ihren täglichen 128 Minuten online 11 Minuten (4%) auf Bewegtbild – ein Minus von 4 Minuten gegenüber dem Vorjahr. Die 14- bis 29-Jährigen verbrachten damit von ihren täglichen 245 Minuten online 30 Minuten (19%) – ein Minus von 2 Minuten. Die Forscher konstatieren, dass es für die Befragten immer schwieriger werde zu sagen, ob ein Bewegtbild über das Internet oder über klassische Verbreitungswege zu ihnen kommt und ob es sich um TV-Inhalte oder Webvideo handelt. Daher werde für die ARD/ZDF-Onlinestudie die Abfrage des Tagesablaufs im kommenden Jahr grundlegend umgestellt (ebd.: 452 f.).
Beim klassischen Fernsehen lag demgegenüber die durchschnittliche tägliche Sehdauer 2016 bei etwa 240 Minuten. Selbst bei den 14- bis 29-Jährigen erreichte TV eine Tagesreichweiten von 46 Prozent – mit leicht sinkender Tendenz. Bei der Nutzungsdauer könne das klassische Fernsehen seine Stärke als Lean-Back-Medium ausspielen. Sich online über eine Fernsehsendung zu unterhalten, die man gerade sieht, ist besonders unter 14- bis 29-Jährigen verbreitet (33%, +11%). Kupferschmitt mutmaßt: „Offenbar besteht bei den jüngsten Zuschauern durchaus ein Bedürfnis nach Linearität und relevanten Inhalten, die zur Kommunikation anregen. Denn ob öffentlich via Twitter oder privat via WhatsApp kommuniziert wird – Voraussetzung ist ein lineares TV-Ereignis, das von einer gewissen Zahl an Zuschauern gleichzeitig verfolgt wird.“ (ebd.: 458) So war für die ARD/ZDF-Forscher eines der wesentlichen Ergebnisse der Studie 2016, „dass die meisten Menschen Videostreaming eher sporadisch nutzten und dass ein Durchbruch bei täglicher, habitualisierter Nutzung von Onlinevideos allenfalls bei den 14- bis 29-Jährigen zu erkennen war.“ (Kupferschmitt 2016: 448)
Bei der jungen Bevölkerung geht die Bewegtbildnutzung jedoch deutlich weg vom klassischen TV-Gerät. War dieses 2016 für 66,4% der Gesamtbevölkerung das wichtigstes Endgerät für die Fernseh- und Videonutzung, traf das unter den 14- bis 29-Jährigen nur auf 33,7% zu, gefolgt von Laptop oder PC (33,0%) und Smartphone (23,7%). (Chartreport Digitalisierungsbericht 2016: 153)
Die ARD/ZDF-Onlinestudie betrachtet ausschließlich die Rezeption von Medien im Netz. Doch auch die aktive Veröffentlichung von Inhalten nimmt rasant zu. Die „EU Kids Online“-Studie (11/2014 unter Leitung des Hans-Bredow-Instituts) fragte 11- bis 16-Jährige in sieben europäischen Ländern, was sie täglich im Internet tun. Das Posten von Fotos, Videos oder Musik hat darunter von 6% im Jahr 2010 auf 20% 2014 zugenommen.
Was bedeutet das sich verändernde Mediennutzungsverhalten für die Meinungsbildung? Diese Frage untersucht der MedienVielfaltsMonitor der deutschen Medienanstalten. Dazu wird in einem ersten Schritt die jeweilige Relevanz der Mediengattungen Fernsehen, Radio, Internet und Print für die informierende Mediennutzung gewichtet. Aus dem Marktanteil gestern und dem von den Befragten als wichtigstes Informationsmedium genannten errechnet sich das Meinungsbildungsgewicht. 2016 hatte das Fernsehen mit 35,7% weiterhin das größte Gewicht für die Gesamtbevölkerung (-4,6%-Punkte gegenüber 2011), gefolgt von Internet (22,3%), Tageszeitungen (20,7%) und Radio (18,7%). Das Internet hatte 2014 das Radio und 2015 die Tageszeitung überholt. Bei den 14- bis 29-Jährigen liegt das Internet bereits seit 2009 an erster Stelle, 2016 mit 46%, gefolgt von Fernsehen (24,8%), Radio (17,6%) und Tageszeitungen (9,8%). Unter den Internet-Angeboten hat Facebook in dieser Altersgruppe die höchste informierende Tagesreichweite (23%). Es folgen die Online-Angebote von Tageszeitungen (21,9%) und Zeitschriften (19,4%), Youtube (18,5%), Wikipedia (13%) und die Online-Angebote von Fernsehsendern (12,5%) (MedienGewichtungsStudie 2016).
Der eigentliche MedienVielfaltsMonitor für das 1. Halbjahr 2016 verwendet dann diese empirisch ermittelten Gewichtungen um die Anteile von Medienunternehmen in den einzelnen Medienmärkten zu erheben. Demnach wird der gesamte Meinungsmarkt in Deutschland zu mindestens 57,4% von privaten Medienkonzernen geprägt, darunter vor allem Bertelsmann, Springer und ProSiebenSat.1 (zusammen 27,6%), ARD und ZDF erzielen zusammen einen Anteil von 29,6% (Sonstige 15%). Die Konzentration ist leicht zurückgegangen, mit 57,2% des Marktes in Händen der fünf größten Unternehmen auf hohem Niveau. Da sich weitere 29,7% auf 25 und 18,3 Prozent auf zahlreiche weitere Medienanbieter aufteilen, sehen die Forscher den überregionalen Meinungsmarkt in Deutschland von relativ hoher Vielfalt gekennzeichnet.
Betrachtet man die einzelnen Meinungssegmente, ergibt sich ein differenziertes Bild. Durch die Konzentration im Zeitungsmarkt teilen sich nur noch zehn Verlage 70,6% des Marktes (ebd.: 21). Während beim Fernsehen Öffentlich-Rechtliche und Private in etwa gleichauf liegen (ebd.: 17), machen im Internet ARD und ZDF zusammen nur 6,9% aus (ebd.: 27). Den größten Anteil am Meinungsmarkt Internet erzielt Bertelsmann mit insgesamt 9,4%, gefolgt von Axel Springer (u.a. Bild.de, Welt.de) mit insgesamt 8,7%, Burda mit 8,3% und United Internet mit 7,1%. Erst dann kommt die ARD mit 5,2% (ebd: 27).
Der Monitor berücksichtigt primär nur publizistisch relevante Internet-Angebote (professionelle Kommunikatoren, die regelmäßig und aktuell berichten) wie die Online-Ableger von Verlagen und Rundfunkveranstaltern sowie Online-Portale wie die der Telekom (die der Außenwerber Ströer Mitte 2015 übernommen hatte). Suchmaschinen, Videoplattformen und soziale Netzwerke seien für die Informationssuche und Nachrichtenverbreitung zwar von großer Bedeutung, aber sie seien keine Online-Medien mit eigens erstellten Inhalten. Daher hat ihnen der Monitor einen Platz im Anhang eingeräumt.
Von den 29,3% ihrer täglichen Online-Zeit, die durchschnittliche Deutsche informierend nutzen, verbringen sie 11,2% auf Facebook, 8,1% auf Youtube und 1,6% auf Twitter (ebd.: 34). Als Suchmaschine verwenden die Deutschen fast ausschließlich Google (95,9%). Laut Gewichtungsstudie gehen Suchmaschinen mit 7,6% in die Meinungsbildung ein. Daraus errechnet der Monitor, dass rund 7% der Bevölkerung Google täglich informierend nutzen (ebd.: 30).
Die Öffentlich-Rechtlichen im Internet: Amsterdam-Tests
Im Netz gibt es eine virtuell unendliche Stimmenvielfalt, nur eines gibt es ohne die Öffentlich-Rechtlichen nicht: eine journalistisch-redaktionelle Selbstbeobachtung der Gesellschaft im öffentlichen Auftrag und Interesse, unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen, qualitätsgesichert nach den höchsten Standards der journalistischen Zunft, der Gesellschaft Rechenschaft leistend, mit einer Perspektive auf die Vielfalt des Gesellschaftsganzen. Mit der Popularisierung des Internet Mitte der 1990er und seiner sich abzeichnenden Bedeutung für die Meinungsbildung war es daher nur folgerichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigene Websites starteten, die BBC 1995, ARD und ORF 1997. Die Mediathek des ZDF startete 2001, die der ARD 2008.
Gleichzeitig waren kommerzielle Medienunternehmen aus Print und Funk bemüht, im Internet wirtschaftlich Fuß zu fassen. Der Misserfolg führte sie dazu, einerseits den neuen Internet-nativen Diensten die Schuld zu geben, allen voran Google. Die Verlage lobbyieren seit Jahren in den Mitgliedsländern und der EU für ein urheberrechtliches Leistungsschutzrecht, also eine Abgabe, die in erster Linie Google den Verlagen dafür zahlen solle, dass es in seiner Google News-Suche Titel und die ersten zwei Zeilen von Artikeln der Verlage präsentiert und diesen damit Leserinnen zuführt. Den anderen Schuldigen machten Verlage und Privatfunker in den Öffentlich-Rechtlichen aus, die mit ihren beitragsfinanzierten Angeboten mutmaßlich kommerzielle Angebote verhinderten.
Die Europäische Union hatte als Nachtrag zu ihrem Gründungsdokument 1997 im Vertrag von Amsterdam bestimmt, dass die öffentliche Finanzierung von öffentlich beauftragtem Rundfunk zulässig ist. In seiner Entschließung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von 1999 bekräftigte der Europäische Rat das Amsterdamer Protokoll und stellte klar, dass die Öffentlich-Rechtlichen bei der Erfüllung ihres Auftrags weiterhin den technologischen Fortschritt nutzen müssen:
„Entsprechend dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von den Mitgliedstaaten definiert wird, kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine bedeutende Rolle dabei zu, der Öffentlichkeit die Vorteile der neuen audiovisuellen Dienste und Informationsdienste sowie der neuen Technologien nahezubringen.
Die Fähigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Öffentlichkeit Programme und Dienste von hoher Qualität anzubieten, muß gewahrt und ausgebaut werden, einschließlich der Entwicklung und Diversifizierung der Tätigkeiten im digitalen Zeitalter.“ (EU Rat 1999: Rnd.nrn. 5 und 6)
2001 legte die Kommission ihre 1. Rundfunkmitteilung (2001/C 320/04) vor. Darin verweist sie auf ihre ein Jahr zuvor veröffentlichte Mitteilung über Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, in der sie die zentrale Bedeutung audiovisueller Medien „für das Funktionieren der heutigen demokratischen Gesellschaften und insbesondere für die Entwicklung und Vermittlung gemeinsamer sozialer Werte“ hervorhob. Die wirtschaftsliberale, auf den Binnenmarkt ausgerichtete Kommission erkennt hier eine kategoriale Verschiedenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an, der im Interesse der Allgemeinheit von Beginn an einer besonderen Regelung unterlag. „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist trotz seiner klaren wirtschaftlichen Bedeutung nicht mit öffentlichen Anbietern anderer Wirtschaftszweige vergleichbar. Es gibt keinen Dienst, der gleichzeitig so viele Menschen erreicht, die Bevölkerung mit einer großen Menge an Informationen und Inhalten versorgt und damit individuelle Ansichten wie öffentliche Meinung verbreitet und beeinflusst.“ (ebd.)
Ferner gab die EU-Kommission in ihrer 1. Rundfunkmitteilung Hinweise zur Anwendung des Beihilferechts, zur Definition und Erteilung des öffentlich-rechtlichen Auftrags, zu den Transparenzanforderungen, die eine klare Trennung zwischen gemeinwirtschaftlichen und anderen Tätigkeiten der Anstalten vorschreiben und zur Verhältnismäßigkeit der Finanzierung, die eine Überkompensierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen verhindern soll. Schließlich betont sie, dass eine Prüfung der Vereinbarkeit von Rundfunkbeiträgen mit dem Gemeinsamen Markt durch die Kommission nur im Einzelfall erfolgen könne.
Seit 1998 gingen Beschwerden von Unternehmen und Verbänden der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage und des privaten Rundfunks aus Deutschland, UK, Österreich und anderen Mitgliedsländern bei der EU-Kommission ein. Sie richteten sich insbesondere gegen Online-Dienste, die mutmaßlich nicht unter den öffentlich-rechtlichen Auftrag fielen und damit gegen europäisches Beihilferecht verstießen (Liste aller EU-Beihilfeverfahren gegen ÖRM).
Im Hinblick auf die sich abzeichnenden Anforderungen der EU-Kommission wurde in Britannien mit der Charter-Erneuerung der BBC im Jahr 2004 der Public-Value-Test eingeführt, der primär auf die Abwägung des Public Value eines BBC-Angebots gegenüber seinen möglichen schädlichen Auswirkungen auf den Markt abzielt.
Das Verfahren gegen Deutschland wurde 2007 mit einem Beihilfekompromiss abgeschlossen (EU Kom. 2007). Darin sagte Deutschland zu, die öffentliche Beauftragung durch ein dreistufiges Prüfverfahren für alle neuen oder veränderten digitalen Angebote der öffentlichen Rundfunkanstalten zu präzisieren. Für jedes Angebot ist demnach zu klären, „dass es (1) zum öffentlichen Auftrag gehört und damit die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen einer Gesellschaft entspricht [sic], dass es (2) in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt und dass (3) der Aufwand für die Erbringung des Angebotes vorgesehen ist.“ (ebd.: Rnd.nr. 328) Diese Prüfanforderungen wurden als Drei-Stufen-Test fast wörtlich im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Dezember 2008 übernommen. Als Folge der neuen Regel musste das ZDF mehr als achtzig Prozent seiner Online-Inhalte ‘depublizieren’ (Dörr in Donders/Moe 2011: 79; zum Wandel in der Konzeption von informationeller Grundversorgung vgl. Grassmuck 2014).
Im selben Staatsvertrag sind außerdem nichtsendungsbezogene presseähnliche Angebote der Anstalten, also solche, „die nach Gestaltung und Inhalt Zeitungen oder Zeitschriften entsprechen“, für nicht zulässig erklärt worden. Auf diese Norm stützte sich dann die Klage von Zeitungsverlegern gegen die Tagesschau-App, die 2011 begann (Keese 2011) und im September 2016 vom Oberlandesgerichts Köln zugunsten der Verleger entschieden wurde (OLG Köln, 30.09.2016 – I-6 U 188/12). Das Gericht erkannte die App in der Form, in der sie an dem zu prüfenden Tag im Juni 2011 vorlag, für presseähnlich. Da sich das Angebot der ARD seither verändert hat und mehr Video- und Audio-Informationen enthält, hat das Urteil keine unmittelbaren Folgen (Heise 30.09.2016). Im Zuge des Verfahrens gab es weitere Klagen von Zeitungsverlegern, so gegen die Nachrichten-App BR24 des Bayerischen Rundfunks, die im Juni 2016 mit einer Unterlassungserklärung des BR endete (Heise 07.06.2016) und die im April 2017 eingereichte Klage gegen die Nachrichten-App RBB24 des Rundfunks Berlin-Brandenburg (Heise 18.04.2017).
Aus Österreich waren 2004 und 2005 Beschwerden des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ) und des Verbandes Österreichischer Privatsender (VÖP) vor allem gegen die Online-Angebote des ORF bei der EU-Kommission eingegangen. Im Dialog sicherte die Republik Österreich zu, die Aufträge des ORF zu konkretisieren und zu kontrollieren, kommerzielle Tätigkeiten des ORF nicht mit Programmentgelten zu subventionieren und eine unabhängige Finanzaufsicht sowie einen Public Value Test einzuführen. Daraufhin sah die EU-Kommission ihre Bedenken ausgeräumt und teilte mit Schreiben vom 28.10.2009 (EU-Kom. 2009a) die Einstellung des Verfahrens mit. Am 16. November gab die Bundesregierung die Einigung auf ein neues ORF-Gesetz bekannt, das die zugesagten Änderung umsetzte, darunter das als Auftragsvorprüfungsverfahren bezeichnete Prüfverfahren (vgl. Bartenberger 2010: 93 f.).
Einen Tag vor der Einstellungsmitteilung an Österreich hatte die EU-Kommission ihre 2. Rundfunkmitteilung (2009/C257/01) vorgelegt. Seit der 1. Rundfunkmitteilung 2001 hatte sie mehr als zwanzig Entscheidungen über die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten getroffen sowie mehrere Konsultationen dazu durchgeführt. Der EuGH hatte im Altmark-Urteil von 2003 (EuGH, 24.07.2003 – C-280/00) festgelegt, unter welchen Voraussetzungen Ausgleichzahlungen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen keine staatliche Beihilfe darstellen. Auch das 2005 von der Unesco verabschiedete Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen war einschlägig, das Maßnahmen wie den öffentlichen Rundfunk zulässt, die darauf abzielen, die Medienvielfalt zu erhöhen. Vor dem Hintergrund des sich rasch verändernden neuen Medienumfelds unternahm es die EU-Kommission „als Hüterin des EU-Vertrags“ in ihrer 2. Rundfunkmitteilung von 2009 die Kriterien zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu konsolidieren. ÖRM sind als „Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind“ (Artikel 106 Abs 2 EUV (Web, Epub)) unter bestimmten Voraussetzungen vom Beihilfeverbot ausgenommen. Diese sah sie in Auslegung der Altmark-Entscheidung des EuGH und des Protokolls von Amsterdam in einem klar definierten und hoheitlich betrauten Auftrag und in der Verhältnismäßigkeit der Finanzierung (Rd.nr. 38).
Konkret schreibt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten für neue und wesentlich veränderte audiovisuelle Dienste ihrer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein vorheriges Beurteilungsverfahren vor, in dem zu prüfen ist, ob die jeweiligen Dienste den sozialen, demokratischen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft dienen (Rd.nr. 84). Im Rahmen der Prüfung ist eine offene öffentliche Konsultation durchzuführen, „um Transparenz zu gewährleisten und alle für eine fundierte und ausgewogene Entscheidung erforderlichen Informationen zu erhalten“ (Rd.nr. 87). Schließlich müssen die Mitgliedstaaten durch eine von den Anstalten unabhängige Instanz die Gesamtauswirkungen neuer Dienste auf den Markt untersuchen lassen, um sicherzustellen, dass die öffentliche Finanzierung den Handel und den Wettbewerb nicht in einem Ausmaß verzerrt, das dem gemeinsamem Interesse zuwiderläuft (Rd.nr. 88)
In der Mitteilung machte die EU-Kommission detaillierte Vorgaben für Auftrag, Kontrolle, Finanzierung, Transparenz und kommerzielle Tätigkeiten öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, anhand derer sie beihilferechtliche Beschwerden entscheidet, und sie führte besagtes vorheriges Prüfverfahren europaweit ein, das als Amsterdam-Test bekannt wurde. 2014 hatten acht europäische Ländern derartige Prüfverfahren eingeführt, darunter UK den Public-Value-Test, der 2016 in Public Interest Test umbenannt wurde, Deutschland den Drei-Stufen-Test und Österreich die Auftragsvorprüfung. Fünf der Länder hatten bis dato insgesamt 56 Entscheidungen getroffen, davon Deutschland alleine 45. Davon wurde nur ein einziges Angebot in Großbritannien nicht genehmigt (Bohdal/Belfin 2014: 12 f.).
Über den Umweg des Beihilferechts hat die EU-Kommission gewissermaßen ein europäisches Rundfunkrecht geschaffen. Die Debatte über die Bedeutung öffentlich-rechtlicher Medien als Teil der Daseinsvorsorge, über ihren Public Value, ihren Auftrag und ihre Kontrolle mit den vorgeschriebenen Transparenzpflichten und Konsultationen hat dazu geführt, dass die ÖRM in den drei untersuchten Ländern heute eine deutlich größere Transparenz und Accountability gegenüber der Gesellschaft, die sie beauftragt, praktizieren als je zuvor.
Dabei sichern die EU-Bestimmungen die Entwicklungsoffenheit bei der Erfüllung der gesellschaftlichen Bedürfnisse. Bei Einschränkungen wie Verweildauern oder dem Verbot von presseähnlichen Angeboten, das in Deutschland und Österreich virulent ist, handelt es sich um ohne europäische Not eingeführte nationale Regelungen. Die Zeitungskrise haben diese Verbote nicht abgewendet.
Allein die im Amsterdam-Test vorgeschriebene Überprüfung der möglichen Marktauswirkungen von nicht-marktlichen, öffentlich beauftragten Angeboten sticht aus dem europäischen Rechtsrahmen heraus. Da sie zwingt, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, handelt sich um einen offenkundigen Kategorienfehler. Gerade in der marktfixierten Argumentation der EU-Kommission wird deutlich, dass ÖRM eine Daseinsberechtigung allein aus ihrer öffentlichen Beauftragung beziehen und sie ihre marktlichen Aktivitäten strikt davon zu trennen haben. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat seit der Einführung des dualen Systems den Unterschied zwischen ÖRM, die es mit einem Grundversorgungsauftrag ausstattete, und privatwirtschaftlichen Medien, denen es geringere Anforderungen der Vielfaltssicherung auferlegte, betont. Im jüngsten Rundfunkurteil zum ZDF-Fernsehrat vom 25.03.2014 spricht es von zwei verschiedenen Entscheidungsrationalitäten, die im Nebeneinander von privatem und öffentlich-rechtlichem Rundfunk aufeinander einwirken. Die spezifische Eigenrationalität des privatwirtschaftlichen Rundfunks folge naturgemäß marktwirtschaftlichen Anreizen, die die verfassungsrechtlich gebotene inhaltliche Vielfalt nicht gewährleisten können. Außerdem führe der erheblichen Konzentrationsdruck im privatwirtschaftlichen Rundfunk zu Risiken einer einseitigen Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung (ebd.: Rd.Nr. 36)
Demgegenüber unterliegt der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch seine öffentliche Finanzierung einer anderen Eigenrationalität und damit eigenen Möglichkeiten der Programmgestaltung. „Auf dieser Basis kann und soll er durch eigene Impulse und Perspektiven zur Angebotsvielfalt beitragen und unabhängig von Einschaltquoten und Werbeaufträgen ein Programm anbieten, das den verfassungsrechtlichen Anforderungen gegenständlicher und meinungsmäßiger Vielfalt entspricht. … Entsprechend dieser Bedeutung beschränkt sich sein Auftrag nicht auf eine Mindestversorgung oder auf ein Ausfüllen von Lücken und Nischen, die von privaten Anbietern nicht abgedeckt werden, sondern erfasst die volle Breite des klassischen Rundfunkauftrags, der neben seiner Rolle für die Meinungs- und Willensbildung, neben Unterhaltung und Information eine kulturelle Verantwortung umfasst und dabei an das gesamte Publikum gerichtet ist“ und entwicklungsoffen für neue Inhalte, Formen und Technologien (ebd.: Rd.Nr. 37).
Daraus folgt, dass öffentlich-rechtliche und private Medien sich nicht auf demselben Spielfeld befinden und nicht mit denselben Maßstäben gemessen werden können. Der unsinnige und kostspielige Marktauswirkungstest im Amsterdam-Test ist daher abzuschaffen. Natürlich spielen ÖRM als Marktakteure eine wichtige Rolle bei der Förderung von Märkten der Film- und Kreativwirtschaft (Mazzucato 2015), doch gerade dafür ist eine strikte Trennung von Auftragserfüllung und kommerziellen Aktivitäten unerlässlich. Gerade ihre Schnittstellen zum Markt (Beauftragungen, Koproduktionen, Einkauf von Rechten, Verkauf von Rechten an öffentlich-rechtlichen Inhalten usw.) sind besonders kritisch und bedürfen daher einer besonderen Transparenz und Aufsicht (vgl. Grassmuck 2017).
(A)soziale Medien
Im Raum der „vernetzten Öffentlichkeit“ (Yochai Benkler) treffen die ÖRM nicht nur auf Verlage und Privatfunker, sondern auch auf Bürgerinnen und Bürger – nicht als Quotenmacher per Fernbedienung oder als Leserbriefschreiber, sondern, zumindest formal, auf Augenhöhe.
Als Mitte der 1990er die Massenverbreitung des Internet begann, schürte es Hoffnungen auf eine Demokratisierung der Öffentlichkeit. Anlass dafür gab nicht zuletzt die offene Informations- und Diskussionskultur, die in den Newsgoups des 1979 gestarteten Usenet entstanden war (s. Michael und Ronda Hauben, Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet, 1996). Das World Wide Web mit seiner Auszeichnungssprache HTML (Hypertext Markup Language) erlaubte spätestens mit dem ersten populären Webbrowser Mosaic (1993) jedem mit Zugang zu Webspace, Webseiten nicht nur zu lesen, sondern auch zu erstellen.
Auch in den 1990ern gab es bereits offene Kontributorensysteme wie das Open Video Archive (OVA) und andere kooperative Websites, doch erst Anfang der Nullerjahre wurde die Entwicklung zu Online-Communities so markant, dass unter dem Begriff „Web 2.0“ ein neue Phase des Internet eingeläutet wurde. Dazu gehören Blogs, auf denen jedermann schreiben kann, Wikis die es erlauben, gemeinsam Webseiten direkt im Browser zu bearbeiten (das berühmteste ist natürlich die 2001 gestartete Wikipedia), Podcasts, virtuelle Welten wie Second Life, Social Bookmarks, Media-Sharing-Plattformen wie das 2005 gegründete und 2006 von Google gekaufte Youtube und soziale Netzwerke wie das 2004 gestartete Facebook. Der Digital-Verleger Tim O’Reilly definierte:
„Web 2.0 is the business revolution in the computer industry caused by the move to the internet as platform, and an attempt to understand the rules for success on that new platform. Chief among those rules is this: Build applications that harness network effects to get better the more people use them. (This is what I’ve elsewhere called ‘harnessing collective intelligence.’)“ (O’Reilly 10.12.2006)
Mit Plattformen als zentralem Element des Internet und Netzwerkeffekten, die die Konzentrationsprozesse der Akteure vorantreiben, hat O’Reilly die Dynamik benannt, die den Digitalraum bis heute bestimmt. Offene Community-Sites von NGOs oder Hochschulen gibt es zwar weiter, doch das Gros der Aufmerksamkeit und der Wertschöpfung konzentriert sich auf immer weniger globale Plattformen wie Facebook, Google, Amazon, Airbnb und Uber. Plattformen wie Myspace, Studi-VZ oder Altavista waren zu Ihrer Zeit Marktführer, sind jedoch der Konkurrenz ihrere Nachfolger erlegen. Wie Shopping-Malls im öffentlichen Raum laden die Plattformen alle ein, ihre Dienste zu benutzen, nach den Regeln des von ihnen verhängten Hausrechts. Die in der Regel kostenlosen Dienste ‘bezahlen’ Nutzer/innen vermeintlich mit ihren persönlichen Daten, tatsächlich mit dem Preis für die Produkte und Dienstleistungen, die durch Profil-gestütztes Mikrotargeting beworben werden.
Während andere noch die „Sharing-Ökonomie“ feierten, die sich die Cebit 2013 als „Shareconomy“ zum Leitthema wählte, entlarvte sie Sascha Lobo 2014 als Euphemismus für die neue digitale Wirtschaftsordnung, die er „Plattform-Kapitalismus“ nennt. Das Internet senkte Eintrittsbarrieren und versprach durch direkte Kontakte eine Disintermediation: die Umgehung von Mittelsmännern. Tatsächlich, so Lobo, seien Intermediäre mächtiger als je zuvor. „Klassische Mittelsmänner waren Händler, Plattformen sind eine Art Meta-Händler: Sie kontrollieren den Zugang und die Prozesse eines ganzen Geschäftsmodells. Plattformen möchten nicht die Besten im Spiel sein, sondern die Regeln des Spiels bestimmen. Sie sind ökonomische Ökosysteme, die Geld verdienen, indem sie Dritten ermöglichen, Geld zu verdienen.“ Als Beispiele nennt er Google Adsense, das Profit macht mit der gebührenpflichtigen Vermittlung von Aufmerksamkeit, das 2005 gegründete Amazon Mechanical Turk mit der Vermittlung von digitalen Kleinstdienstleistungen und Uber mit der Vermittlung von privaten Fahrdienstleistungen (Sascha Lobo, Spiegel 03.09.2014).
Lobo hebt besonders ab auf die damit ausgelöste Veränderung des Arbeitsbegriffs. Das Verschwimmen der Grenzen von Festanstellung, freiberuflichem Schaffen, Hobbyarbeit, privater Hilfe und Schwarzarbeit lässt ihn befürchten, dass der Plattform-Kapitalismus „eine Dumpinghölle schafft, in der ausgebeutete Amateure nur dazu dienen, die Preise der Profis zu drücken.“ (ebd.)
Mindestens ebenso gravierend wie für Arbeit sind Plattformen für die vernetzte Öffentlichkeit. Die Meinungsmacht der Intermediäre wird zu einem immer drängenderen Thema in der öffentlichen Debatte.2 In der von Lutz Hachmeister seit 1995 erstellten Liste der 50 größten Medien- und Wissenskonzerne der Welt, kommen 2017 klassische Medienunternehmen kaum mehr vor. Auf Platz eins steht jetzt Alphabet, das neue Dachunternehmen von Google. Aus der Suchmaschine ist ein diversifizierter Konzern geworden, der aber weiterhin 98 Prozent seines Umsatzes mit Werbung generiert (Hachmeister/Wäscher 2017: 74 ff.).
Grundlage für das Werbegeschäft von Google, Facebook & Co. sind massenhafte Personendaten ihrer Nutzer. Solche Datenkonzentrationen sind nicht nur an sich problematisch, sie ziehen auch weitere Interessen auf sich. Dank der Enthüllungen von Edward Snowden über das Prism-Programm, wissen wir, dass die US-National Security Agency direkten Zugriff auf die Systeme von Google, Facebook, Apple, Microsoft und anderen US-amerikanischen Internet-Größen hatte (Guardian 07.06.2013). Während Snowdens Enthüllungen über die globale Massenüberwachung sehr wohl zu Gegenbewegungen führten (Amnesty International 04.06.205) haben sie vor allem die Gewissheit etabliert, dass jede unserer Bewegungen im Netz sichtbar ist, für Unternehmen und ihre Partner, für Geheimdienste und für Hacker jeglicher Couleur im eigenen oder fremden Auftrag.
Und zu alledem gibt es Hinweise, dass Soziale Medien einsam und unglücklich machen, was ihrem weiter wachsenden Erfolg jedoch keinen Abbruch tut. Die Tagesreichweite von Facebook unter 14- bis 29-Jährigen in Deutschland beträgt aktuell 56,6%, unter allen Onlinern 41,8% (Schmidt et al. 2017: 15).
Die US-amerikanische Psychologin Sherry Turkle hat die Sozialisation des Computers von Anfang an erforscht, oder vielmehr unsere Sozialisierung in eine Welt, die zunehmend vom Computer als einem „evokatorischen Objekt“ bestimmt wird, wie sie in „The Second Self: Computers and the Human Spirit“ (1984) schrieb. Der Computer sei keine Rechenmaschine, sondern eine metaphysische Maschine, ein konstruktives und projektives Medium für die Selbsterforschung. In ihren Gesprächen mit jungen PC-Nutzern und Computer-Spielern stellte sie fest, dass der Computer zu einem „Gegenstand-mit-dem-man-denkt“ geworden ist, ein Spiegel, mit dem man über menschliche geistige Prozesse und die Konstruktion der eigenen Identität nachdenkt.
Ende der 1980er trat aus dieser anthropologischen Bewegung in Japan eine neue Generation ins gesellschaftliche Bewußtsein: Die Otaku meiden direkte Sozialkontakte, haben sich ganz in evokatorischen Medien eingerichtet und begannen sich über Bulletin-Board-Systeme zu vernetzen unter dem Motto „Allein, aber nicht einsam“ (Grassmuck 1990). Auch Turkles zweiter Band ihrer Trilogie über das Verhältnis von Mensch und Computer behandelt diesen Schritt vom Einzelrechner ins Netz. Und wieder sind es Spiele, Multi-User Dungeons (MUDs), in die Spieler ihre Avatare projizieren, von denen die größte Faszination für Identitätsexperimente ausgeht. ‘Auf der anderen Seite des Bildschirms gibt es Menschen’ ist die neue Grunderfahrung von „Life on the Screen“ (1995). Der Computer hat nichts mehr mit Rechnen und alles mit Simulation, Navigation und künstlicher Intelligenz zu tun. MUDs sind interaktive Literatur und partizipatives Theater. Technologie, so Turkle, trage Konzepte der Postmoderne in die Alltagserfahrung, die Instabilität von Bedeutungen, das Fehlen universeller Wahrheiten und dezentrierte, fluide, nichtlineare und opake Entitäten (ebd.: 17 f.) Wir seien Cyborgs geworden, Mischwesen aus Biologie, Technologie und Code (ebd.: 21) und konstruieren uns ein multiples, spielerisches, proteisches Selbst (ebd.: 263 f.). Die Kehrseite ist, dass diese Konstruktion nicht immer gelingt und Turkle auch eine Zunahme von multiplen Persönlichkeitsstörungen (MPD) feststellte (ebd.: 260).
1998 wurde in Japan eine Nachfolgegeneration der Otaku identifiziert: Die Hikikomori steigern die Sozialvermeidung, indem sie monate-, teils jahrelang ihr Zimmer im Haus ihrer Eltern nicht verlassen und TV und Computer als einziges Fenster zur Welt nutzen. Das Symptom hat nicht nur in Asien Konjunktur, die Sozialphobie breitet sich auch im Westen aus. Faszinierende Einblicke in das Innenleben eines Hikikomori bietet der gleichnamige Erstlingsroman von Kevin Kuhn (Berlin Verlag 2012).
Die ersten sozialen Roboter und die Haltungen, die sie bei Menschen evozieren, sind Gegenstand von Turkles drittem Band „Alone Together“ (2011). In den Gesprächen, die sie dafür führte, hörte sie eine Erschöpfung über die Schwierigkeiten des Zusammenlebens mit anderen Menschen. Sie sprachen darüber, wie schwer es ist, Familienmitglieder oder Freunde zu verstehen. Die Anforderungen, die Roboter stellen, seien demgegenüber handhabbarer. Wenn wir einander im Stich lassen oder uns entfremden, finden Menschen Trost darin, dass Roboter da sein werden, dafür programmiert, uns Simulationen von Liebe zu geben. „Our population is aging; there will be robots to take care of us. Our children are neglected; robots will tend to them. We are too exhausted to deal with each other in adversity; robots will have the energy. Robots won’t be judgmental. We will be accomodated.“ (ebd.: 10) Was als Ersatz begann, wo direkter Kontakt nicht möglich ist, wird nun attraktiver als das, was es ersetzt. Eine Rentnerin sagte Turkle über ihren Roboterhund: „It is better than a real dog. … It won’t do dangerous things, and it won’t betray you. … Also, it won’t die suddenly and abandon you and make you very sad.“ (ebd.) Die Vorführung von Intimität tritt an die Stelle menschlicher Nähe. „We don’t seem to care what these artficial intelligences ‘know’ or ‘understand’ of the human moments we might ‘share’ with them. At the robotic moment, the performance of connection seems connection enough. … Social robots serve as both symptom and dream: as a symptom, they promise a way to sidestep conflicts about intimacy; as a dream, they express the wish for relationships with limits, a way to be both together and alone.“ (ebd.: 9 ff.)
Machen Soziale Medien einsam? Die empirischen Befunde dazu sind nicht eindeutig. Immer wieder zeigen Studien, dass soziale Fähigkeiten im direkten Kontakt unter Online-Kommunikation leiden (Huffington Post 07.10.2016). Andere Hinweise deuten darauf, dass die Selbstfindung in der Pubertät noch nie einfach war und heutige Jugendliche ein größeres Problem damit haben, in die Social-Media-Soziopathen-Ecke gestellt zu werden als mit Einsamkeit (Guardian 08.04.2017).
Eine Langzeitstudie in den USA hat nun robust etabliert, dass Social Media unglücklich machen. Die beiden Wissenschaftler befragten von 2013 bis 2015 jeweils eine repräsentative Gruppe von 5.208 Personen nach ihren Facebook-Aktivitäten, ihren persönlichen sozialen Beziehungen und der Einschätzung ihrer physischen und metalen Gesundheit und ihrer Zufriedenheit. Die Ergebnisse zeigen, dass Facebook negativ mit Wohlbefinden korreliert ist. „A 1-standard-deviation increase in ‘likes clicked’ (clicking ‘like’ on someone else’s content), ‘links clicked’ (clicking a link to another site or article), or ‘status updates’ (updating one’s own Facebook status) was associated with a decrease of 5%–8% of a standard deviation in self-reported mental health.“ Im Unterschied zu einer Zunahme an persönlichen Beziehungen führt eine Zunahme an Facebook-Aktivitäten zu einer signifikanten Abnahme der Zufriedenheit. „While screen time in general can be problematic, the tricky thing about social media is that while we are using it, we get the impression that we are engaging in meaningful social interaction. Our results suggest that the nature and quality of this sort of connection is no substitute for the real world interaction we need for a healthy life.“ (Holly B. Shakya und Nicholas A. Christakis, Harvard Business Review 10.04.2017).
Filterblasen und Echokammern
Angesichts ihrer Bedeutung für die Meinungsbildung im Netz rechnet Hachmeister Technologie-Unternehmen wie Google und Facebook zurecht den Medien- und Wissenskonzernen zu, auch wenn diese keine Redaktionen unterhalten. Vielmehr verwenden sie automatisierte algorithmische Verfahren zur Filterung und Selektion von Informationen. Suchergebnisse, die Mischung der Beiträge in der Facebook-Timeline, die Empfehlungen auf Youtube wären von Menschen ohnehin nicht zu organisieren, aber auch vermeintlich publizistische Angebote wie Google News und Facebook News kommen ganz ohne menschliche Redakteure aus (zu Facebooks News-Algorithmus s. Social Media Today 23.04.2017).
Aus Korrelationen in Massendaten und dem individuellen Profil mit Freundesnetzwerk und Kommunikationsgeschichte generieren solche Automatismen Informationsströme, die vermeintlich perfekt auf die eigenen Interessen abgestimmt sind, im Extremfall mit einer Zielgruppe der Größe eins. Damit erzeugen sie einerseits aus der gigantischen und unaufhörlichen Informationsflut des Netzes überhaupt eine menschlich wahrnehmbare Selektion. In der in den 1980ern virulenten Debatte über Informationsüberlastung schien ein solcher „Daily Me“-Informationsdienst die Lösung. Andererseits schränken sie das Wahrnehmbare ein auf das für den Nutzer vermeintlich Relevanteste, und das wird meist als Mehr von dem operationalisiert, was er aktiv ausgewählt hat.
Politisch motivierte Informationspräferenzen und ihre Folgen für die deliberative Öffentlichkeit und die Demokratie werden bereits seit den 1940ern kontrovers diskutiert. Dabei wurde eine Neigung zur Meinungsbestätigung und Vermeidung von Dissonanzen konstatiert, die die Informationsauswahl steuern (confirmation bias). Auch persönlich umgeben wir uns gern mit Menschen, die uns in Alter, Bildungsgrad, Lebensstil, Interessen usw. ähnlich sind (Homophilie).
Genau diese Neigungen zum Ähnlichen werden nun für die algorithmisch personalisierte Informationsselektion verwendet und verstärken damit die Abschottung gegenüber anderen Meinungen. Für diesen Effekt prägte der Internet-Aktivist Eli Pariser 2011 den Begriff „Filter Bubble“. Es begann laut Pariser, als sich der Ingenieur und Informatiker Jeff Bezos Mitte der 1990er fragte, wie man die Empfehlungen der Nachbarschafts-Buchhändlerin, die uns seit Jahren kennt, auf das Internet skalieren könnte. Die Antwort fand er im maschinellen Lernen, künstlicher Intelligenz und ersten Experimenten in kooperativer Filterung. Als Bezos 1995 den Versandhändler Amazon gründete, war Personalisierung bereits eingebaut. Wer sich ein Buch ansieht, bekommt angezeigt, welche Bücher andere Kunden, die sich für dieses Buch interessieren, noch gekauft haben. Je mehr Menschen Bücher bei Amazon kauften, desto besser wurden die personalisierten Empfehlungen (Pariser 2011: 18 ff.).
Auslöser für Parisers Filterblasen-Theorie war eine wenig beachtete Mitteilung von Google im Dezember 2009: Die Suchmaschine begann ihre Ergebnisse zu personalisieren und verwendet dazu 57 ‘Signale’ (Betriebssystem, Browser, Standort, frühere Suchabfragen usw.). Seither erhalten Menschen, die dasselbe Suchwort in Google eingeben, individuell verschiedene Ergebnisse angezeigt (ebd.: 6). Ähnliches geschah auf Facebook. Pariser, der sich als links-geneigt bezeichnet, hatte gezielt einige Konservative unter seinen Facebook-Freunden aufgenommen. Als deren Posts aus seiner Timeline verschwanden, mutmaßt er, dass Facebook registriert hatte, dass er häufiger auf die Posts seiner progressiven Freunde klickte – und ihm deshalb keine konservativen Botschaften mehr anzeigte (ebd.: 8).
Die psychologische Neigung zum Gleichen habe es immer gegeben, so Pariser. Die algorithmische Verstärkung der Filterblasen bringe jedoch drei gänzliche neue Dynamiken mit sich: Erstens sind wir in unserer Blase allein. Noch die kleinteiligste Zielgruppe eines Kabelkanals brachte Menschen zusammen. Zweitens ist die Filterblase unsichtbar. Bei traditionellen Nachrichtenquellen wissen die meisten Rezipienten, ob es sich um eine konservatives oder ein liberales Medium handelt und können aktiv wählen. Die Auswahl, die Plattformen aufgrund der Annahmen über uns für uns treffen, sind aus der Blase heraus unmöglich zu erkennen, geschweige denn zu beeinflussen. Und drittens ist es nicht unsere Entscheidung, uns in eine Filterblase zu begeben. Während wir Zeitungen und TV-Sender auswählen, treffen Plattformen mit ihren personalisierten Filtern diese Entscheidungen für uns (ebd.: 10). Und wie genau Algorithmen die Nutzerwahrnehmung beeinflusse, können nicht einmal ihre Betreiber vorhersagen. Das sagte Jonathan McPhie, Leiter der Suchpersonalisierung bei Google gegenüber Pariser: Dafür geben es einfach zu viele Variablen (ebd.: 12).
Demokratie benötigt eine Öffentlichkeit, in der Fragen von öffentlichem Interesse verhandelt werden, die persönliche Interessen und Nischen überschreiten. Sie beruht auf gemeinsamen Themen und Informationen für eine öffentliche Meinungsbildung. „Democracy requires citizens to see things from one another’s point of view, but instead we’re more and more enclosed in our own bubbles. Democracy requires a reliance on shared facts; instead we’re being offered parallel but separate universes.“ (ebd.: 8).
Die Filterblase scheint das Interesse der Unternehmen, uns möglichst viel zu verkaufen, mit unserem Interesse, angeboten zu bekommen, was uns interessiert, zu einer perfekten ‘Konsumentensouveränität’ zu verbinden. Zugleich schränkt sie die wahrnehmbare Vielfalt ein und verstärkt damit Quoteneffekte und den Trend zum Sensationellen, zum Boulevard. Wenn es nicht um Konsumenten in einem Markt geht, sondern um Bürger in einer Demokratie, stellen Filterblasen daher eine Gefahr dar. Statt widerstreitende Meinungen aufeinander treffen zu lassen, entfalten sie Zentrifugalkräfte, die uns auseinander treiben, eine Fragmentierung in Teilöffentlichkeiten, die untereinander nicht mehr kommunizieren und sich intern polarisieren.
Genau deshalb verpflichten demokratiepolitische Erwägungen öffentlich-rechtliche Medien, Meinungsvielfalt zu sichern. Zusammenhänge zwischen Ereignissen, Informationen und Meinungen herzustellen und mit einer Auswahl aus allen Themenressorts das relevante Tagesgeschehen abzubilden, war bislang Aufgabe von Journalisten und Redakteurinnen. Diese Aufgabe kann kein Algorithmus der Welt ihnen abnehmen.
Doch Algorithmen sind Teil unserer Informationsumgebung geworden. In dieser Lage forderte Pariser mehr Transparenz und mehr Kontrolle durch die Nutzer. Unternehmen müssten der Öffentlichkeit transparenter machen, wie ihre Filtersysteme funktionieren. Er nennt auch die Einwände der Unternehmen: Algorithmen sind Geschäftsgeheimnisse, die vor der Konkurrenz geschützt werden müssen, und, wenn sie bekannt würden, könnten sie manipuliert werden (ebd.: 125). Was er nicht erwähnt, ist die grundsätzliche Problematik: Selbst wenn Googles PageRank-Algorithmus und seine 57 Parameter der Personalisierung bekannt sind, können nicht einmal deren Entwickler die Suchergebnisse in einem konkreten Fall voraussagen. Auch die Nutzer selbst oder eine zwischengeschaltete unabhängige Ombudsperson stünden vor demselben Problem.
Zusätzlich schlägt Pariser vor, dass Personalisierung ausschaltbar oder umkehrbar (‘zeige mir Ergebnisse, die mir wahrscheinlich nicht gefallen’) gemacht werden solle (ebd.: 128). Schließlich schlägt er vor, in den Strom des Immergleichen eine Portion Serendipity einzufügen, also Zufallsfunde zu ermöglichen, die überraschende Entdeckungen auslösen, ein Forderung, die auch Medienwissenschaftler wie Miriam Meckel teilen (SOS – Save Our Serendipity, 11.10.2011).
Parisers Forderung nach Kontrolle der Nutzer über ihre persönlichen Daten richtete sich auf ein Datenschutzrecht, das es mit der Datenschutz-Grundverordnung in Europa inzwischen gibt, das auch in den USA schon in den 1970ern unter Nixon vorgeschlagen worden war, aber bis dato dort noch nicht umgesetzt worden ist (ebd.: 130 f.).
Die Filterblase ist seither fester Bestandteil der öffentlichen Debatte wie der Forschung über Medien. Parisers zentrale Aussage – „The filter bubble tends to dramatically amplify confirmation bias“ (ebd.: 51) – ist empirisch jedoch bislang nicht nachgewiesen worden.
Schon 2009 hatte der US-Kommunikationswissenschaftler Kelly Garrett auf der Suche nach den Filterblasen verwandten Echokammern, in denen nur Gleichgesinnte miteinander sprechen, gezeigt, dass der Wunsch nach Verstärkung der eigenen politischen Meinung zwar die Auswahl von Informationen im Netz beeinflusse, dass umgekehrt jedoch konträre Meinungen nicht gemieden werden. Die Befürchtungen, das Internet führe zu einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft hält er daher für übertrieben (Garrett 2009).
Die Mainzer Kommunikationswissenschaftlerin Birgit Stark fand in einer repräsentativen Tagebuchstudie zur Politischen Meinungsbildung auf Facebook (2017) weder die Voraussetzungen für Filterblasen für die breite Masse, noch seien Echokammer-Effekte nachweisbar. Wohl aber sieht sie durch die Beobachtung des Meinungsklimas und der Signale zu Aktualität und Wichtigkeit in Sozialen Medien sowie durch sich aufschaukelnde Aufmerksamkeitsspiralen oder Medienhypes die Voraussetzungen für Polarisierung gegeben.
Eine auf Gruppen- und Einzelinterviews gestützte Untersuchung des Hans-Bredow-Instituts Zur Relevanz von Online-Intermediären für die Meinungsbildung kam zu dem Ergebnis, dass Intermediäre relevant sind und die Wissens- und Informationssuche mit ihrer Hilfe immer starke Züge der Personalisierung zeige. „Die Studie brachte allerdings keine Hinweise darauf, dass sich Personen in algorithmisch generierten Filterblasen befänden (wohl aber, in einigen Fällen, in persönlich gewählten)“. (Schmidt et al. 2017: 96).
Ein Team am Institut für Informationsrecht der Universität Amsterdam erstellte 2016 unter dem Titel Should we worry about filter bubbles? (Borgesius e.a. 2016) eine Übersicht der empirischen Forschung zu den Auswirkungen von selbst-ausgewählter und algorithmischer Personalisierung. Demnach kann ein Polarisierungseffekt als etabliert gelten, der dazu führt, dass Menschen, die sich einer sehr einseitigen, ihre Meinung unterstützenden Informationskost aussetzen (Echokammer), dazu neigen, ihre Ansichten zu radikalisieren. So konnte für die USA anhand repräsentativer Wahldaten gezeigt werden, dass Monoinformationelle im Laufe des Wahlkampfes in ihren Ansichten extremer geworden sind (ebd.: 8). Die algorithmische Selektion von Informationen sei noch zu jung für empirisch gestützte Aussagen. Allerdings deuten einige großangelegte Experimente auf ein erhebliches Beeinflussungspotential. So konnte Facebook durch die Manipulation der Timeline von fast 700.000 Nutzern zeigen, dass die Reduktion von positiven Äußerungen dazu führte, dass die betroffenen Nutzer selbst weniger Positives posteten und umgekehrt (Kramer, Guillory & Hancock 2014). Auch dass die massenhafte Manipulation von Suchergebnissen bis zu 20% unentschiedene Wähler in das eine oder andere Lager treiben kann, ist experimentell nachgewiesen (Epstein und Robertson 2015). Die Amsterdamer Forscher schließen, dass es noch keine Beweise für demokratie-schädliche Auswirkungen von algorithmischen Filterblasen gibt, aber warnen uns achtsam zu bleiben:
„We conclude that – in spite of the serious concerns voiced – at present, there is no empirical evidence that warrants any strong worries about filter bubbles. Nevertheless, the debate about filter bubbles is important. Personalisation on news sites is still at an infant stage, and personalised content does not constitute a substantial information source for most citizens, as our review of literature on media use has shown. However, if personalisation technology improves, and personalised news content becomes people’s main information source, problems for our democracy could indeed arise, as our review of empirical studies of media effects has shown.“ (Borgesius e.a. 2016: 10)
Brexit und Trump
Zwei Großereignisse aus dem vergangenen Jahr haben in dem Amsterdamer Forschungsüberblick noch keinen Niederschlag gefunden: Brexit und Trump. In beiden Fällen war das Abstimmungsergebnis eine Überraschung für die meisten Beobachter. Tiefgreifender war jedoch die Erschütterung über den Grund für die Überraschung: Medien und Demoskopen hatten den Verbleib Britanniens in der EU und den Wahlsieg Clintons als sicher vorausgesagt. Es handelt sich also nicht nur um zwei Einzelentscheidungen, sondern um ein Versagen des journalistischen und wissenschaftlichen Sensoriums, das uns doch über den tatsächlichen Zustand der Gesellschaft unterrichten soll. Die anhaltende Suche nach Erklärungen fördert Befunde einer tiefen Spaltung der Gesellschaft nach verschiedenen Faktoren wie Alter, Einkommen, Multikulturalität und nicht zuletzt Bildung zu Tage. Und sie zeigte Vielfaltsdefizite in Form von Filterblasen auf Seiten der Informationsproduktion wie -Rezeption.
Der New Statesman verweist in einer Analyse des britischen EU-Referendums zunächst auf eine Generationskluft: Mit wachsendem Alter stieg auch die Zustimmung zu ‘Leave’. Die Daten dafür seien eindeutig. Dann berichtet der Autor über die Fassungslosigkeit, mit der das Ergebnis unter Studierenden aufgenommen wurde. Die überwältigende Mehrheit von ihnen hätten für einen Verbleib gestimmt und sich nicht vorstellen können, dass so viele ihrer Landsleute anders entschieden. Der Grund: Universitäten seien zu Echokammern geworden, in denen intensiv über Political Correctnes und Meinungfreiheit debattiert wird, bis hin zur Ächtung andere Meinungen, die aber die Verbindung zur Gesellschaft verloren hätten. Soziale Netzwerke hätten den confirmation bias weiter verstärkt. Leave-Anhänger seien hier schnell als ungebildet und fremdenfeindlich tituliert worden, was viele von ihnen zum Schweigen gebracht hätte, on- und offline. „Echo chambers – preaching to the converted – will do little to heal the divisions of post-Brexit society.“ (New Statesman 06.07.2016)
Das New Yorker Online-Magazin FiveThirtyEight identifizierte eine liberale Medienblase als Ursache für die Verkennung von Trumps Chancen. Las man die New York Times, musste man schon drei Wochen vor der Wahl davon ausgehen, dass Hillary Clinton gewinnen würde. Dass das Gegenteil für das Gros der Journalisten undenkbar war, führt der Autor auf die sozioökonomische Homogenität von US-Journalisten und Politikexperten zurück. Dabei bezieht er sich auf eine Untersuchung an der Indiana University, derzufolge 2013 92% der Journalisten in den USA einen College-Abschluss hatten. Sie waren älter, überwiegend weiß, in der Mehrheit männlich (die Zahl der weiblichen (37,5%) und der Journalisten aus Minderheiten (8,5%) ist zwischen 2002 und 2013 noch zurückgegangen), und sie verdienten überdurchschnittlich gut (7.000 US$ im Jahr mehr als der Landesdurchschnitt). Hinzu kommt eine wachsende Ungleichheit in der politischen Orientierung. 2013 bezeichneten sich nur 7,1% der Vollzeitreporter als republikanisch, gegenüber 28,1% demokratisch und 50,2% unabhängig (Willnat/Weaver 2014). Die Politikexperten In dieser homogenen Gruppe, so FiveThirtyEight, beziehen sich vorwiegend aufeinander. Auf diese Weise entsteht eine sich selbst verstärkende Meinungsblase, die Journalisten auch dann mit sich tragen, wenn sie gelegentlich in die Mitte des Landes reisen. Die Neigung, von meinungsführenden Medien abzuschreiben, markierte bereits der ältere Begriff der Echokammer. Soziale Medien, vor allem Twitter, beschleunigten diesen Effekt nun zu einer „Rudelmentalität“, in der sich ein Konsens über das Framing eines Ereignisses in Echtzeit bilde. (FiveThirtyEight 10.03.2017).

Auch Politico ging der Frage nach, warum Scharen von Reportern ausgestattet mit den besten Umfragedaten und Analysen in der Berichterstattung über die US-Wahl versagt hatten. Die USA sind durch eine Zweiparteiensystem gekennzeichnet und eine soziodemographische Spaltung zwischen den Eliten an der Ost- und Westküste und dem Rest des Landes. Und auch die Medien, so der Befund von Politico, sind in wachsendem Maße an den Küsten konzentriert und bilden eine confirmation bias-Blase, die unvorstellbar macht, was den eigenen Vorstellung widerspricht.
Dazu glichen sie Beschäftigungs- und Wahldaten ab und stellten fest, dass die Arbeitsplätze von Journalisten immer stärker an den Küsten konzentriert sind und dort in den am stärksten demokratisch wählenden Bezirken. Nationale Zeitungen, Zeitschriften, Radio und TV sind traditionell in New York und Los Angeles konzentriert. Politikberichterstattung fokussiert naturgemäß auf Washington, Wirtschaftsjournalismus auf New York. Dem stand jedoch eine große Zahl von Zeitungen und Radiostationen in größeren und kleineren Städten im ganzen Land gegenüber. Durch das Zeitungssterben hat sich die Zahl der bei Zeitungen Beschäftigten 2017 gegenüber 1990 mehr als halbiert. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Internet-Publikationen, die heute mehr als doppelt so viele Arbeitslätze schaffen wie in den Zeitungen verloren gehen. Obwohl das Internet dezentrales Arbeiten möglich macht, ballen sich auch diese Unternehmen wieder zusammen, entweder im Boston-New York-Washington-Richmond-Korridor oder an der Westküste von Seattle und San Diego bis Phoenix, und dort in urbanen Bezirken, die überwiegend für Clinton gestimmt haben. „72 percent of all internet publishing or newspaper employees work in a county that Clinton won. By this measure, of course, Clinton was the national media’s candidate.“ (Politico Mai/Juni 2017)
Eine bewusste Komplizenschaft der Presse mit Hillary Clinton halten die Politico-Autoren nicht für überzeugend, schließlich sei über die geleakten Clinton-Emails und andere für sie negative Vorkommnis weithin berichtet worden. Vielmehr könnten Medienmacher gar nicht anders, als von ihrer Umgebung beeinflusst zu werden, von der liberalen Geisteshaltung in einer Zeitung wie der New York Times und in kosmopolitischen Städten wie New York, San Francisco, Boston und Washington. Die hier vorherrschenden Haltungen zu Themen wie Abtreibung, Schwulenrechte, Schusswaffen oder Umweltschutz spiegeln sich in diesen Medien wieder, ob CNN, CBS, Times, Washington Post, BuzzFeed oder eben Politico. Folge dieses Gruppendenkens in den weißen, wohlhabenden, männlichen, älteren, kosmopolitischen Küstenblasen sei, so die Politico-Autoren, dass sich große Teile der US-Bevölkerung mit ihrer Weltanschauung in diesen Medien nicht repräsentiert sahen und sich dem sich als Anti-Mainstream-Medium gerierenden Fox News und alternativen Informationsquellen wie Breitbart zuwandten. Trump erkannte das Potenzial und setzte in seinem Wahlkampf ganz auf diese Medien und auf die ländlichen USA, deren Mentalität sie ausdrücken.
Die Lösung für die durch die Blase entstehende Kurzsichtigkeit seien keine Umerziehungslager für Journalisten oder Minderheitenquoten bei der Einstellung, obwohl kleine Dosen von beidem nicht schaden könnten. „Journalists respond to their failings best when their vanity is punctured with proof that they blew a story that was right in front of them. If the burning humiliation of missing the biggest political story in a generation won’t change newsrooms, nothing will. More than anything, journalists hate getting beat.“ (Politico Mai/Juni 2017)
Auch wenn gesicherte wissenschaftliche empirische Erkenntnisse noch ausstehen, spricht alle anekdotische Evidenz dafür, dass algorithmische Filterung diese Blaseneffekte massiv verstärkt. Wired-Autor Mostafa M. El-Bermawy war schockiert, als er am Tag vor der US-Präsidentschaftswahl die Daten zu Clinton und Trump auf Sozialen Netzen, Websites und in der Google-Suche studierte. Schockiert, weil er das Ausmaß von Trumps Popularität völlig unterschätzt hatte. Die Daten zeigten mehr Follower und höhere Engagement-Raten auf allen Plattformen. Ein Text mit dem Titel „Why I’m Voting For Donald Trump” ist anderthalb Millionen Mal geteilt worden, – aber nie in El-Bermawys Facebook-Newsfeed aufgetaucht. Und auch nicht in dem sämtlicher liberaler New Yorker Freunde, die er gefragt hat.
 Millenials, die in den zwanzig Jahren vor der Jahrtausendwende Geborenen, beziehen ihre politischen Informationen zu 61% primär aus Facebook, wie eine Pew-Umfrage Anfang 2014 zeigt. Doch Mark Zuckerberg weigert sich vehement anzuerkennen, dass Facebook ein Medienunternehmen ist. Tatsächlich sei es ein Technologieunternehmen, das für seine Nutzer Werkzeuge baut, mit denen sie ihre Erfahrungen und Kommunikationen kuratieren können, aber es produziere und editiere selbst keine Inhalte. Der Grund ist klar: Zuckerberg will damit der Medienverantwortung nach Presserecht und Berufsethik entgehen und sich ganz darauf konzentrieren, Angebote und Nachfragen algorithmisch abzugleichen und damit die Werbeeinnahme zu maximieren.
Millenials, die in den zwanzig Jahren vor der Jahrtausendwende Geborenen, beziehen ihre politischen Informationen zu 61% primär aus Facebook, wie eine Pew-Umfrage Anfang 2014 zeigt. Doch Mark Zuckerberg weigert sich vehement anzuerkennen, dass Facebook ein Medienunternehmen ist. Tatsächlich sei es ein Technologieunternehmen, das für seine Nutzer Werkzeuge baut, mit denen sie ihre Erfahrungen und Kommunikationen kuratieren können, aber es produziere und editiere selbst keine Inhalte. Der Grund ist klar: Zuckerberg will damit der Medienverantwortung nach Presserecht und Berufsethik entgehen und sich ganz darauf konzentrieren, Angebote und Nachfragen algorithmisch abzugleichen und damit die Werbeeinnahme zu maximieren.
El-Bermawys Schock bestand in der Erkenntnis, mit welcher Perfektion Facebooks Algorithmen verschiedene Filterblasen gegeneinander isolieren. Bis zu dem Punkt, an dem die eine Hälfte der USA nicht mehr erkennen konnte, dass die andere Hälfte Trump zum Präsidenten machen würde (Wired 18.11.2016).
Hate Speech, Fake News und Postfaktizität
Die US-Analyse ist natürlich nicht direkt auf Europa übertragbar, die Tendenzen zeigen sich jedoch auch hier. Alte und neue Medienmacher sind in den Hauptstädten Wien, London, Berlin konzentriert und auch demogragphisch sind sie ganz ähnlich gefiltert. Von Parisers algorithmisch verstärkter Filterblase aus erkennen wir rückblickend, dass es das Phänomen schon immer gegeben hat. Tatsächlich ist schon Habermas’ Urszene der Öffentlichkeit, das Kaffeehaus, eine solche: Eintrittspflicht und Zugangsverbot für Frauen schufen einen Ort des sozial gefilterten männlichen Bildungsbürgertums. Das galt auch für den Beginn des Rundfunks, der bevorzugt Lesungen, Theaterstücke, Konzerte, Hörspiele zu Bildung und Erbauung sendete, bevor sich der bildungsbürgerliche Habitus in Deutschland und Österreich in der nationalsozialistischen Vermassung verlor. Und auch das Internet war, solange fast nur Menschen in Hochschulen und Forschungseinrichtungen es nutzen konnten, demographisch sehr homogen.
Anders das vor und parallel zum öffentlich-rechtlichen Radio entstandene Amateurradio und sein lizenzfreier Nachbar CB-Funk. Der um 1905 entwickelte Kristalldetektor erlaubt es auch Jugendlichen, von ihrem Taschengeld einen Radioempfänger zu bauen. Bald folgten Vakuumröhren, und es kamen Zeitschriften für das neue high-tech Hobby auf, mit Bauanleitungen für Sender und Empfänger. Vor der durchgreifenden Regulierung Anfang der 1920er brachten Hunderttausende Radioamateure eine Kommunikationsvielfalt hervor, die gelegentlich mit dem Internet verglichen wird (s. a. Crawford 2008), die anders als dieses aber nie akademisch gefiltert war. 1914 schlossen sich die Amateure in den USA zur American Radio Relay League (ARRL) zusammen. In Deutschland gründeten die Radiobastler aus der Arbeiterbewegung 1924 den Arbeiter-Radio-Klub Deutschlands.
Diese Erfahrung und die staatliche Schließung des Äthers veranlassten Bertolt Brecht zu seinem Vorschlag zur Umfunktionierung des Rundfunks. Das Publikum dürfe nicht nur belehrt werden, sondern müsse auch belehren:
„Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Deshalb sind alle Bestrebungen des Rundfunks, öffentlichen Angelegenheiten auch wirklich den Charakter der Öffentlichkeit zu verleihen, absolut positiv. …
Der Rundfunk muss den Austausch ermöglichen. Er allein kann die großen Gespräche der Branchen und Konsumenten über die Normung der Gebrauchsgegenstände veranstalten, die Debatten über Erhöhungen der Brotpreise, die Dispute der Kommunen. Sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie, darüber nachzudenken, warum es utopisch ist. … Undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar in einer anderen, dienen die Vorschläge, welche doch nur eine natürliche Konsequenz der technischen Entwicklung bilden, der Propagierung und Formung dieser anderen Ordnung.“ (Brecht, Der Rundfunk als Kommunikationsapparat, 1932)
Anders als im bildungsbürgerlich gefilterten Rundfunk waren auf den Amateurfrequenzen auch sozialistische Botschaften zu hören und statt des Kaffeehauses die Stimme des Stammtisches. Freunde, die heute noch gelegentlich in den Amateur- und CB-Funk reinhören, berichten von einem hohen Anteil an Alltagsrassimus, Fremdenfeindlichkeit und Sexismus in den Gesprächen.
Das Internet erlebte seinen ersten Kulturschock, als die geschlossenen und kommerziellen Bulletin Board Systems (BBS) wie CompuServe und MCI 1989 Gateways zum Internet öffneten. Die Internet-Gemeinschaft hatte eine Selbstregulierung durch die Netiquette und eine Acceptable Use Policy hervorgebracht, die Werbung auf den öffentlich finanzierten Netzen untersagte. Mit einem Mal kam eine Flut von entschieden nicht-akademischen Menschen hinzu, die Mail und Foren als kommerzielle Dienste kennen gelernt hatten. Mit ihnen kamen Werbemails und bald auch in ihrer Massenform als Spam (Helmers e.a. 2000: 24). Die Netizens sahen durch diese ‘Außenseiter’ die Unschuld ihrer Welt verloren. Die Kultur des freien Informationsaustausches war von der feindliche Übernahme durch Besetzer und Rancher bedroht, die Stacheldraht ziehen. Die Befürchtung war, dass auch im Internet bald für jedes Byte bezahlt werden müsse und öffentliche Orte wie Hochschulen, Bibliothek und Museen niedergetrampelt würden (Waldrop 1994).
Und auch der Umgangston wurde rauer. In deutschen BBSs taucht ebenfalls 1989 erstmals rechtsextreme Propaganda auf. Bald errichteten Nazis ihr eigenes BBS-Netzwerk, aber entdeckten auch die Newsgroups des Internet für sich (Wikipedia: Rechtsextremismus im Internet).
Heute ist das Internet in allen demographischen Ecken der Gesellschaft angekommen. Damit wurde die letzte Hoffnung, dass Weltoffenheit, ein zivilisiertes, respektvolles Miteinander und ein rationaler Wettstreit der Ideen doch irgendwie strukturell ins Internet einkodiert sein könnten, die alle affizieren, die damit in Berührung kommen, enttäuscht.
Neben Weltoffenheit gehören zum Internet nun auch Hass, Rassismus, Sexismus und andere Formen von „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“. Diesen Begriff prägte der Bielefelder Soziologe und Pädagoge Wilhelm Heitmeyer für das Syndrom feindseliger Einstellungen gegenüber Menschen verschiedener Andersartigkeit: Juden, Homosexuelle, Obdachlose, Behinderte, Muslime, Arbeitslose, Asylbewerber, Sinti und Roma usw. Dabei beanspruchen Alteingesessenen, gleich welcher Herkunft, ein Etabliertenvorrecht, eine Vorrangstellung, die den diskriminierten Gruppen Gleichwertigkeit und gleiche Rechte abspricht, bis hin zu Grundrechten wie Menschenwürde und Unversehrtheit. Heitmeyer forschte als einer der ersten Mitte der 1980er Jahre zu rechtsextremistischen Orientierungen bei Jugendlichen und Mitte der 1990er Jahre zu fundamentalistischen Orientierungen bei muslimischen Jugendlichen. 1996 gründete er an der Universität Bielefeld das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG). Und er begründete die Bielefelder Theorie sozialer Desintegration. Demnach ist soziale bzw. gesellschaftliche Integration von Individuen und Gruppen ein gelungenes Verhältnis von Freiheit und Bindung, in dem die Teilhabe an materiellen Gütern, die institutionelle Fairness und kulturell-expressive Chancen auf Anerkennung gesichert sind. Nehmen Desintegrationserfahrungen und -ängste durch sozioökonomische Polarisierung, politische Machtlosigkeit und instabile sozioemontionale Beziehungen zu, wachsen auch Ausmaß und Intensität der gruppenbezogenen Konflikte.
Diese untersuchte das IKG in einer Langzeitstudie zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, eine jährliche repräsentativen Bevölkerungsbefragungen zwischen 2002 und 2011, die unter dem Titel „Deutsche Zustände“ erschienen sind. Nachdem nach der Wende 1989 die rechtsextreme Gewalt in erschreckendem Maß angestiegen war, stellten die Forscher bis Mitte des ersten Jahrzehnts eine Abnahme fest, die durch die Finanzkrise 2008 wieder umgekehrt wurde. „Schon 2002 haben wir auf die Gefahr des Rechtspopulismus hingewiesen. Wir hatten ihn gemessen mit Fragen nach Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und autoritärer Aggression. Danach stellte sich ein Potenzial von 20 Prozent in der Bevölkerung heraus“, sagte Heitmeyer im Interview im Oktober 2016. Die politischen und medialen Eliten hätten es somit wissen können, aber sie wollten es nicht wissen. Weder waren Jungnazis ein opportunes Thema, noch wollten Migrationsforscher und Islamverbände etwas über eine Radikalisierung junger Muslime hören. „Zwischen 2009 und 2011 stiegen bei diesem Potenzial die wahrgenommene Einflusslosigkeit als ein Grundelement von Wut, die Bereitschaft an Demonstrationen teilzunehmen sowie die individuelle Gewaltbereitschaft deutlich an. Das war vor dem Aufkommen von Pegida oder AfD. Die Mobilisierungsakteure haben es geschafft, die individuellen Ohnmachtsgefühle in kollektive Machtgefühle zu verwandeln.“ (Berliner Zeitung 22.10.2016).
Desintegrationserfahrungen und Vertrauensverlust in Eliten sind keineswegs auf den rechten Rand beschränkt. Eine Neoliberalisierung des Sozialen treibe sie bis in die Mitte der Gesellschaft, was eine Normalisierung der Abwertungen schwacher Gruppen verstärke. „Wir haben auch auf das Phänomen einer ‘rohen Bürgerlichkeit’ hingewiesen, weil wir feststellten, dass sich hinter der glatten Fassade wohlgesetzter Worte oft ein Jargon der Verachtung verbirgt. In neuerer Zeit zeigt sich auch die Tendenz, Menschengruppen nach Kriterien der Effizienz, Verwertbarkeit und Nützlichkeit zu bewerten. Das sind Gesichtspunkte, die in der kapitalistischen Wirtschaft funktional sind. Das Fatale ist, dass sich diese Maxime in die sozialen Lebenswelten hineingefressen hat. Es ist eine der verhängnisvollsten Entwicklungen der letzten Jahre. Der Kapitalismus ist übergriffig geworden.“ (ebd.).
Genau zu dieser Erkenntnis, dass rechtsextreme Einstellungen in allen Bevölkerungsschichten anzutreffen sind, informiert eine vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig ebenfalls seit 2002 alle zwei Jahre durchgeführte repräsentative Befragung. Seit die Ergebnisse der Studie von 2006 unter dem Titel „Vom Rand zur Mitte“ zusammengefasst wurden, heißt sie die „Leipziger ‘Mitte’-Studie“. Im Dialog mit Heitmeyers Konzepten setzten die Leipziger Forscher vor allem auf eine Milieu-Methodik. Diese zeigte, dass antidemokratisch und menschenfeindlich eingestellte Milieus sich selbst der Mitte zurechneten und mehrheitlich entweder CDU/CSU oder SPD wählten. Den Einstellungen folgen nicht notwendig Handlungen – weder war für sie die NPD als offen rechtsextreme Partei wählbar noch neigten sie zu gewalttätigen Aktionen (Decker e.a. 2016: 57 f.). Antidemokratische Einstellungen, so der Befunde der Langzeitstudie, seien mit der Wirtschaftskrise von 2007 rapide angestiegen, seit 2014 jedoch wieder zurückgegangen.
Die Leipziger ‘Mitte’-Studie 2016 unter dem Titel „Die enthemmte Mitte“ (Decker e.a. 2016) war die erste nach Gründung der AfD im Februar 2013 und nach der Formierung von Pegida im Oktober 2014 in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Die Wahlerfolge der AfD erklären die Forscher aus deren Fähigkeit, erst zur Eurokrise und dann zur „Flüchtlingskrise“ zu mobilisieren. „Mit der Polarisierung der politischen Milieus und der Verschiebung des politischen Diskurses nach rechts können rechtsextreme und rechtspopulistisch auftretende Parteien nun Anhängerinnen und Anhänger mobilisieren, die bisher von rechten Parteien nicht erreicht werden konnten.“ (ebd.: 68)
Mit Hilfe einer Cluster-Analyse bestimmter Einstellungen unterscheiden die Leipziger Forscher sechs politische Milieus, zwei demokratische, ein ressentimentgeladenes und drei antidemokratisch-autoritäre Milieus (ebd.: 100 ff.). Das rebellisch-autoritäre Milieu ist darunter das kleinste mit dem geschlossensten rechtsextremen Weltbild. 2006 gehörten ihm 11,4% der Befragten an, 2016 waren es 7,3%. Sozialdarwinismus und die Verharmlosung des Nationalsozialismus finden hier Zustimmung, während sie in der übrigen Bevölkerung keine zentrale Rolle mehr spielen. Die Akzeptanz der Demokratie ist hier gegenüber allen anderen Milieus am niedrigsten, die ausdrückliche Befürwortung einer Diktatur mit 31,1% am höchsten (ebd.: 128 ff.).
2006 lag die Parteipräferenz der Angehörigen des rebellisch-autoritären Milieus mehrheitlich bei den beiden großen Parteien (CDU/CSU 33.6%, SPD 32,6%, Nichtwähler 15,3%, NPD 2,1%). Die AfD hat diese Präferenzen deutlich verschoben. 2016 erreichte sie in diesem Milieu 29,6%. Besonders groß war auch die Gruppe der Nichtwähler mit 23,8%. Nur noch 15,7% hätten die CDU/CSU gewählt, 12,9% die SPD. „Nur noch 38,7% würden sich selbst noch in der politischen Mitte verorten, während sich 34,7% als rechts und 6,4% als rechts außen einstufen.“ (ebd.: 132 f.)
Wie bei den Entscheidungen für Brexit und Trump, aber auch bei den aktuellen Wahlen in Frankreich wird eine Bewegung erkennbar, die sich gegen das politische Establishment, gegen die Mainstream-Medien, gegen Grundprinzipien der Demokratie, gegen Menschenrechte und selbst gegen die Wissenschaft richtet. Der Habermasianische rationale Diskurs wird verlassen hin zu Gefühlen und Glauben. Das Wort des Jahres 2016 – „postfaktisch“ (und im Englischen „post-truth“) – markiert eine öffentliche Debatte, in der gefühlte Wahrheiten wichtiger sind als Tatsachen. Z. B. antwortete Georg Pazderski, Landesvorsitzender der AfD Berlin, in einer Wahlkampfveranstaltung auf die Frage, warum seine Partei nie erwähne, dass 98 Prozent der Migranten in Deutschland friedlich leben: „Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht da drum, wie das der Bürger empfindet. Das heißt also: das, was man fühlt, ist auch Realität.“ (Süddeutsche 07.09.2016)
Die Polarisierung wird durch verschiedene Faktoren verstärkt, durch die Parteiwerdung rechtspopulistischer Bewegungen, durch die Eigenlogik der Massenmedien und durch die Möglichkeiten technischer Verstärkung im Netz.
Während Mainstream-Medien von Pegida- und AfD-Anhängern als „Lügenpresse“ tituliert werden, sucht die AfD deren Aufmerksamkeit, und diese bereiten ihr willig eine Plattform mit Millionenpublikum. Natürlich müssen Medien über Phänomene von fraglos gesellschaftlicher Relevanz berichten und sie kritisch hinterfragen. Genauso natürlich drängt es sich dort auf Aufregerthemen auzuwählen, wo es gerade um das Aufeinandertreffen von Meinungen, um die Polarisierung geht – in den Talkshows. Nicht zuletzt, weil sie gut sind für die Quote und damit das wichtigste Datum für Profit der Privaten und Legitimität der ÖRM. Die ARD Monitor Redaktion nahm sich die 141 Talkshows von ARD und ZDF aus dem Jahr 2016 vor und stellte fest, dass sich mehr als die Hälfte mit dem Themenfeld Flüchtlinge, Islam und Terrorismus sowie Populismus beschäftigte. Themen, die die Nation beschäftigten, die aber auch die AfD zentral stellte. Deren Vertreter wurden entsprechend häufig eingeladen, ob bei Maybrit Illner, Frank Plasberg, Anne Will oder Sandra Maischberger. Umgekehrt schließt die AfD „GEZ-Medien“, Handelsblatt, Spiegel, FAZ und andere von ihren Veranstaltungen aus (Tagesspiegel 15.01.2017).
Die AfD arbeitet bewusst mit sorgfältig geplanten Provokationen und politisch inkorrekten Äußerungen, um ihre Themen auf die öffentliche Agenda zu setzen. Ihr Interesse an Skandalisierung ergänzt sich mit dem der Talkshow-Macher an polarisierendem Streit. Alarmistische, reißerische Titel und Moderationen verstärken vorhandene Ängste, statt sie im unaufgeregten Gespräch einzuordnen und ihnen mit Fakten zu begegnen. Andere relevante Themen werden in den Hintergrund gedrängt. Der ehemaliger Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sieht Talkshows als wesentlichen Teil einer hysterisch gewordenen politischen Kommunikation (Monitor 19.01.2017).
Die Empörungsbewirtschaftung in Talkshows und ihre Adelung menschenfeindlicher Botschaften war in den letzten Monaten Thema der kritischen Selbstreflexion der (öffentlich-rechtlichen) Medien (Spiegel 15.05.2016, Zapp 02.12.2016, Deutschlandfunk Kultur 13.12.2016, RT Deutsch 24.01.2017, taz 26.02.2017, Meedia 29.03.2017, der Rechtsextremismus-Experte David Begrich im Interview mit der Böll-Stiftung 04.05.2017). Auch die jüngste Menschenfeindlichkeitsstudie der Bielefelder Forscher – 2016 unter dem Titel “Gespaltene Mitte” – thematisiert die Rolle der seriösen Medien, die Polarisierung forcieren, indem sie Bedrohungsrhetorik übernehmen und populistischen Akteuren ein Forum bieten. Sie „befördern damit die Strategie der Neuen Rechten, Positionen, die vormals von allen als eindeutig undemokratisch und rechtsextrem verstanden wurden, nun als eine legitime Möglichkeit im Meinungsspektrum anzusiedeln. Den unbedarften Zuschauer erreichen dann zur besten Sendezeit menschenfeindliche und antidemokratische Botschaften, die ihm geadelt und abgesegnet durch die seriös erscheinende politische Debattenrunde, als offenkundig denk-, sag- und durchführbar erscheinen.“ (Zick e. a. 2016: 16 f.)
Rassismus und Sexismus aus dem Sagbaren auszugrenzen ist Ziel der Bewegung für „Politische Korrektheit“. Es war gerade eine Sensibilisierung für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Sprache, aber auch im Lehrplan der Hochschulen, die Mitte der 1980er in den USA zu Forderungen nach Ausweitung des Lehrstoffs auf weibliche und außereuropäische Autoren und zur Entwicklung von nichtdiskriminierenden Begriffen führte. Dank Cultural Studies, Womens, Afro-American, Queer Studies haben sich die Erkenntnisse über Diskriminierung und das Selbstbewusstsein dieser Gruppen verbessert. Wir haben gelernt, dass „Eskimos“ „Inuit“ heißen und unsere Lösung für genderneutrale Personenbezeichnungen gefunden (Leser*innen, LeserInnen, Leser_innen, abwechselnd oder alle weiblich).
Dann sind zwei Dinge passiert. Aus einer nichtdiskriminierenden Korrektheit ist ein aktiver Moralismus entstanden, der zum Habitus einer neuen Generation von Studierenden an Hochschulen in aller Welt wurde. Hans Ulrich Gumbrecht, Literaturwissenschaftler an der Stanford University, sieht die Gefahr eines Klimas von Einschüchterung, das das intellektuelle Leben erstickt. Er selbst ist Ziel einer Klage über einen „Hang zu frauenfeindlichen Äußerungen“ geworden. Gumbrecht, der 1986 gegen die Professoren rebellierte, gesteht, dass der neue Ton des Umgangs in der jüngsten Studentengeneration ihm fremd bleibe, aber er sieht gerade in dieser Differenz eine utopische Möglichkeit: Die neue Political Correctness könne die Einübung der Überlebensbedingungen in einer multikulturellen Gesellschaft sein, in der die Gefahr wächst, andere mit den als „natürlich“ vorausgesetzten eigenen Meinungen zu irritieren oder gar zu verletzen: Nulltoleranz gegenüber jeder Form von Gewalt und ein Verhaltensstil, der das Anderssein der anderen als Normalfall voraussetzt (NZZ 10.9.2016 / FAZ Blogs 05.11.2016).
Kollegen von Gumbrecht sehen diese Gefahr bereits eingetreten. Robert Samuels, der an der University of California unterrichtet, beschreibt ein Klima, das fast alle zum Schweigen bringt:
„In this fraught cultural environment, practically everyone feels that they are being censored or silenced or ignored. For example, some of my conservative students have told me that they feel like they are the real minorities on campus, and even though Donald Trump won the U.S. presidency, they still think they cannot express their true opinions. On the other side, some of my self-identified progressive activist students believe that political correctness makes it hard to have an open discussion: from their perspective, since anything can be perceived as a microaggression, people tend to silence themselves. Moreover, the themes of political correctness, safe spaces, trigger warnings and free speech have become contentious issues on both the right and the left. What I am describing is an educational environment where almost everyone is afraid to speak.“ (Inside Higher Ed 24.04.2017)
Das träfe, so Samuels, insbesondere die überwiegende Mehrzahl der Lehrkräfte, die keine Lebensanstellung haben und deren Job maßgeblich von den Bewertungen der Studierenden abhängt. „Trigger-Warnungen“ sind für Bücher in den Bibliothek von US-Universitäten vorgeschlagen worden, die bei entsprechend Traumatisierten böse Erinnerungen wachrufen könnten (New Yorker 30.05.2016).
Zum anderen wurde „Political Correctness“ (PC) bereits Anfang der 1990er von der politischen Rechten in den USA in einen Kampfbegriff verkehrt, der einerseits diese Antidiskriminierungsbemühungen diffamieren soll und andererseits von neokonservativen Eliten instrumentalisiert wird, um Kritik an ihrer Dominanz zu unterdrücken. Aus dieser Richtung wird eine Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung angeprangert, Zensur und Denkverbote, Fundamentalismus, Tyrannei, Faschismus, Umerziehungsmethoden wie in Maos Kulturrevolution.
Einmal diffamiert, bricht sich das wieder Bahn, was PC an Menschenverachtendem ausschließen will. ‘Das wird man doch wohl noch sagen dürfen’, begleitet eine bewusste Grenzüberschreitung zum bis dato Unsagbaren. Und da weder die ‘PC-verseuchte Wissenschaft’ noch die ‘Lügenpresse’ sagen, was aus Sicht von AfD-Rechtspopulisten gesagten werden muss, ist eine Fülle von alternativen Quellen entstanden, darunter das Blog Politically Incorrect und WikiMANNia – „die Antithese zur feministischen Opfer- und Hassideologie“. Und auch Tichys Einblick, dem der konservative Intellektuelle Norbert Bolz im Interview erklärt, Trump sei weltpolitisch und kulturell betrachtet positiv. Warum? „Weil man sieht, wer die Schraube der Political Correctness so überdreht, muss mit einer harten Gegenreaktion rechnen. Die Leute lassen sich nicht für dumm verkaufen.“ (Tichys Einblick 30.03.2017)
Schließlich setzt die AfD zur Verstärkung ihrer Botschaften möglicherweise auch auf Mittel, deren Lauterkeit andere anzweifeln. Der Einsatz von Bots ließ sich bislang nicht bestätigen, doch wie eine Analyse des Twitterverhaltens der AfD von Journalisten und Datenanalysten von Tagesspiegel und Netzpolitik.org ergab, bringt ein ungewöhnlich reichweitenstarker Account namens @balleryna der Partei ungebührlich viel Aufmerksamkeit.
„Viele Follower hat Balleryna offenbar durch sogenanntes Follow-Back erhalten: Man setzt sich als ‘folgebereit’ auf Listen, twittert #followback-Hashtags und folgt Accounts zurück, wenn diese einem folgen. Damit erklärt sich auch das recht ausgeglichene Verhältnis zwischen Followern und Accounts, denen gefolgt wird. Kein normaler Mensch würde mehr als 300.000 Accounts folgen. Das von Balleryna verwendete Follow-Back-Verfahren zieht natürlich auch jede Menge Bots an, die sich so mehr Follower verschaffen können.“ (Netzpolitik 20.04.2017).
 Herausragender Ausdruck, Nutznießer und Verstärker der vergifteten Öffentlichkeit ist Donald Trump. Er führt einen „Krieg gegen die Medien“, denen er vorwirft, Fake News und Volksfeinde zu sein, während er selbst regelmäßig Unwahrheiten verbreitet. Die Medien rüsten mit Rechercheteams und Faktencheckern auf (Zapp 2017). Mit dem Time-Titel vom 03.04.2017 erkennt die Presse schließlich die Unwahrheit als definierendes Merkmal von Trumps Präsidentschaft an (Oremus 23.03.2017). Im Time-Interview prägte Trump den Satz, der jede weitere Frage nach Wahrheit mit der unabweisbaren normativen Kraft des Faktischen (Georg Jellinek) vom Tisch wischt: „I guess, I can’t be doing so badly, because I’m president, and you’re not.“ (Time 03.04.2017)
Herausragender Ausdruck, Nutznießer und Verstärker der vergifteten Öffentlichkeit ist Donald Trump. Er führt einen „Krieg gegen die Medien“, denen er vorwirft, Fake News und Volksfeinde zu sein, während er selbst regelmäßig Unwahrheiten verbreitet. Die Medien rüsten mit Rechercheteams und Faktencheckern auf (Zapp 2017). Mit dem Time-Titel vom 03.04.2017 erkennt die Presse schließlich die Unwahrheit als definierendes Merkmal von Trumps Präsidentschaft an (Oremus 23.03.2017). Im Time-Interview prägte Trump den Satz, der jede weitere Frage nach Wahrheit mit der unabweisbaren normativen Kraft des Faktischen (Georg Jellinek) vom Tisch wischt: „I guess, I can’t be doing so badly, because I’m president, and you’re not.“ (Time 03.04.2017)
Mitte März 2017 stellte Trump seinen Haushaltsentwurf vor. Der sieht eine deutliche Steigerung der Ausgaben für Verteidigung und Heimatschutz vor und massive Kürzungen in vielen anderen Ressorts, darunter Umweltschutz, Außenministerium, vor allem Entwicklungshilfe, Soziales, Gesundheit und Kunst. Das Bildungsministerium soll 9,2 Mrd. US$ oder 13,5% seines Etats verlieren. Der Corporation for Public Broadcasting (CPB), die NPR und PBS betreibt, soll die Förderung ganz gestrichen werden. 2016 betrug das Budget der CPB 445 Millionen US$, die sie auf hunderte lokale öffentliche Radio- und TV-Stationen aufteilen, die nationale Programme wie NPR’s “All Things Considered“ verbreiten. CPB-Präsidentin Patricia Harrison in einem Hilferuf an den Congress: „The elimination of federal funding to CPB would initially devastate and ultimately destroy public media’s role in early childhood education, public safety, connecting citizens to our history, and promoting civil discussions – all for Americans in both rural and urban communities.“ (Business Insider 16.03.2017).
Korrelation von Bildungsgrad und Wahlverhalten
Bei der Suche nach Erklärungen für Brexit, Trump, AfD und andere Rechtspopulisten wurden Alter, Einkommen, Migrationshintergrund und andere Faktoren angeführt. Doch eine Korrelation kann inzwischen als empirisch robust angesehen werden: die zwischen Bildungsgrad und Wahlverhalten.
Schon Daten, die kurz nach der Brexit-Entscheidung im Juni 2016 veröffentlicht wurden, deuten darauf hin. In der Folgezeit bemühte sich die BBC um detaillierte Daten. Es gelang ihr, diese aus knapp der Hälfte der Stimmbezirke in Großbritannien zu erhalten. Die Auswertung zeigt, dass Bezirke mit niedrigen Qualifikationen mit signifikant höherer Wahrscheinlichkeit für ‘Leave’ stimmten. Der Bildungsgrad hatte eine höhere Korrelation mit dem Abstimmungsverhalten als jedes andere demographische Merkmal. Er erklärt etwa zwei Drittel der Varianz in den Ergebnissen verschiedener Bezirke (BBC 06.02.2017).
Nach der US-Präsidentschaftswahl hat der Journalist und Statistiker Nate Silver die US-Bezirke nach dem Anteil an College-Absolventen gefiltert und konnte zeigen, dass die best-ausgebildeten US-Amerikaner Hillary Clinton gewählt haben – und umgekehrt. Bildung und Einkommen sind eng korreliert, aber an Gegenden, wo sie auseinanderfallen, konnte Silver zeigen, dass Bildung die Determinante ist (FiveThirtyEight 22.11.2016). Mit der Aussage „I love the poorly educated“ (Telegraph 07.11.2016) lag Trump also genau richtig.
In Deutschland ergab eine Auswertung der Landtagswahl 2011 in Mecklenburg-Vorpommern, dass das Bündnis 90 deutlich stärker von Bürgerinnen und Bürgern mit Abitur oder einem Hochschulabschluss gewählt wurde, während in der Wählerschaft der NPD niedrigere Bildungsabschlüsse überproportional vertreten sind (Landeszentrale für politische Bildung 12.07.2016). Auch die Leipziger Mitte-Studie 2016 führt Parteipräferenz im Verhältnis zur Hochschulreife auf: „Den höchsten Anteil an Wählern mit Abitur haben die Grünen (40,7%), gefolgt von der Linken (35,9%) und der FDP (33,3%). Auch unter denen, die zwar zur Wahl gehen wollen, aber noch unentschieden sind, haben 28,9% als Bildungsabschluss mindestens das Abitur. Bei denen, die noch nicht wissen, ob sie wählen gehen wollen, sind es mit 18% weit weniger. Von den Nichtwählerinnen und Nichtwählern haben nicht einmal 10% das Abitur abgelegt – die Entscheidung, wählen zu gehen, hängt offenbar stark vom Bildungsgrad ab. Die Anhängerinnen und Anhänger der AfD weisen einen deutlich unterdurchschnittlichen Bildungsgrad auf. Im Jahr 2014 lag der Anteil der AfD-Wähler mit Abitur noch bei 21,2% und ist 2016 auf 16,2% gesunken.“ (Decker e.a. 2016: 69)
Für Österreich zeigt eine Auswertung der EU-Wahl im Mai 2014, dass mit jedem höheren Bildungsgrad die Neigung zur FPÖ abnimmt (Die Presse 26.05.2014).
Man kann es somit so drastisch zusammenfassen wie der Politikwissenschaftler Herfried Münkler: „Es gibt große Teile des Volkes, die sind nicht besonders informiert, geben sich auch keine Mühe, glauben aber dafür umso besser genau zu wissen, was der Fall ist. Also: sie sind dumm.” Das heiße jedoch nicht, so Münkler, dass man sie nicht mit der Zeit klüger machen könne. Er sieht hier einen Auftrag zur politischen Bildung oder Erziehung, an dem auch die Parteien mitzuwirken haben. Man müsse sich wieder um die Populismusresistenz der Deutschen bemühen. „Man muss auch wieder investieren in die Sachverständigkeit des Bürgers oder des Wählers. Das ist kein Vorgang, den man ein für allemal gemacht hat und danach hat man nur noch kluge Wähler, sondern das ist eigentlich ein tagtäglicher Prozess oder ein tagtägliches sich Abmühen.“ (Deutschlandfunk Kultur: Tacheles 19.11.2016).
Gesellschaftliche Probleme lösen regelmäßig den doppelten Ruf nach Regulierung und Bildung aus – ob Ausländerfeindlichkeit, Radikalisierungsbereitschaft, Globalisierung, Umwelt, Medienkompetenz, Arbeitsmärkte usw. Den radikalen Veränderung in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung sei nicht mit Protektionismus und künstlichem Schutz von Branchen beizukommen, argumentiert dagegen z. B. Martin Halla, Ökonom an der Universität Innsbruck. Vielmehr müsse das Problem an der Wurzel angegangen werden, in der Schule:
„’Um gerüstet zu sein für das Tempo der Globalisierung und der Digitalisierung, kann überhaupt nur im Bildungssystem angesetzt werden. Hier gilt es mutig zu sein’, sagt er. Jeder Euro, der in die frühkindliche Bildung investiert werde, sei um ein Vielfaches besser investiert, als wenn er später in Maßnahmen gesteckt wird, die Versäumtes ausbügeln sollen. (Bildung statt Mauern für Zukunftsjobs, Tiroler Tageszeitung, 13.03.2017)
Der Bildungsauftrag
Ein umfassenderer internationaler Vergleich übersteigt den Rahmen dieser Studie. Als Hintergrund für die Diskussion der Situation in Österreich wird jedoch im Folgenden auf die Mutter aller öffentlich-rechtlicher Medien und anhaltende Impulsgeberin, die BBC, sowie die Entwicklungen in Deutschland eingegangen.
Der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag in Großbritannien
„Broadcasting is part of the public education system of our society.“ (BRU 1985)
Die British Broadcasting Corporation wurde 1922 von britischen und amerikanischen Elektrogeräteherstellern zur Absatzsteigerung ihrer Rundfunkempfänger als Kapitalgesellschaft gegründet. Die britische Postbehörde erteilte der BBC die exklusive Sendelizenz, um eine chaotische Situation wie im damals unregulierten Äther der USA zu vermeiden. Nachdem die gesellschaftliche Bedeutung der BBC deutlich geworden, ihr Geschäftsmodell jedoch gescheitert war, wurde sie 1926 in eine Körperschaft im Staatsbesitz umgewandelt. Die BBC Ltd. wurde dem von der Regierung ernannten BBC Board of Governors unterstellt, das 2007 durch den BBC Trust ersetzt wurde. Grundlage für die Neuorganisation war die erste Royal Charter vom 20.12.1926. Darin heißt es im Namen König George des Fünften, mehr als zwei Millionen Personen in Großbritannien hätten Lizenzen für den Betrieb von Radioempfängern erworben.
„And whereas in view of the widespread interest which is thereby shown to be taken by Our People in the Broadcasting Service and of the great value of the Service as a means of education and entertainment, We deem it desirable that the Service should be developed and exploited to the best advantage and in the national interest.“ (BBC Charter 1926)
Eine Berufung zur Bildung liege der BBC im Blut, seit in den 1920ern erstmals festgestellt wurde, dass Kinder, die BBC-Radio hörten, in der Schule besser abschnitten (BBC 2004: 35). Unter den öffentlichen Zielen der BBC steht Bildung durchgängig an zweiter Stelle nach Nachrichten und Information. Hier in der Fassung der aktuellen Charter von 2016:
„To support learning for people of all ages: the BBC should help everyone learn about different subjects in ways they will find accessible, engaging, inspiring and challenging. The BBC should provide specialist educational content to help support learning for children and teenagers across the United Kingdom. It should encourage people to explore new subjects and participate in new activities through partnerships with educational, sporting and cultural institutions.“ (BBC Charter 2016)
Schon in den 1930ern produzierte die BBC Fernsehprogramme für Kinder. 1955 gab es über vier Millionen Fernsehempfänger in Großbritannien. 1985 fasste die BBC ihre Kinderprogramme auf BBC One und Two unter dem Namen „Children’s BBC“ zusammen und versah sie mit einer eigenen Moderation. Der Name wandelte sich in den 1990ern zu „CBBC“.
Der Bildungsstrang „BBC Schools“ wurde 1957 eingerichtet. Darin wurden vormittags und am frühen Nachmittag Programme für Kinder im Alter von 5 bis 16 auf BBC One und ab 1983 auf BBC Two ausgestrahlt.
Zum Standbein für die Hochschulbildung wurde die 1969 unter Mitarbeit der BBC gegründete Fernuniversität Open University. Die heute größte öffentliche Hochschule in Großbritannien sollte ursprünglich „University of the Air“ heißen. Die Ausstrahlung von Fernsehkursen im Nachtprogramm auf BBC2 und von Programmen auf BBC Radio 3 und 4 begann im Januar 1971. In den 1990ern wurden die Sendestunden reduziert. 2006 wurde die Rundfunkübertragung von Kursmaterialien zugunsten von Online-Angeboten eingestellt. Seither produziert die Open University weiter akademische und dokumentarische Rundfunkprogramme, die vor allem auf BBC Four ausgestrahlt werden (Highlights aus seiner Geschichte sind in dieser Timeline zu sehen).
Als Wettbewerber der BBC ließ die Regulierungsbehörde Independent Television Authority (ITA), aus der die heutige Ofcom hervorging, schon 1955 den kommerziellen Fernsehanbieter ITV zu. Neben seinen TV-Kanälen betreibt ITV heute auch eine Internet-Plattform namens ITVI. 1982 kam Channel 4 hinzu, ein privater, kommerzieller Sender im Besitz der öffentlichen Hand mit „public service“-Auftrag.
Dass die BBC neben Bildung und Information auch Unterhaltung bieten sollte, war die Vision von John Reith, zunächst Direktor der Kapitalgesellschaft, dann erster Generaldirektor der neuen BBC.3 Die Charter ist bis heute Grundlage der BBC. Sie wird alle zehn Jahre fortgeschrieben. Der durch die Charter erteilte Auftrag wird dann in redaktioneller Autonomie der BBC umgesetzt. Ferner muss sie jährliche Berichte über das vergangene und ihre Pläne für das kommende Jahr vorlegen. Mit jeder Charter-Erneuerung kommt ein Bericht über die Pläne für die kommenden zehn Jahre hinzu.
Charter-Erneuerung 2006: Digitalisierung und Public Value
Die Charter-Erneuerung von 2006 stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die BBC lud dafür mit einem Manifest zu einer öffentlichen Debatte ein, um einen Konsens über ihre weitere Entwicklung zu schaffen: Building Public Value: Renewing the BBC for the Digital World (BBC 2004). Wie nie zuvor sah sich die BBC in Frage gestellt. Viele, darunter auch die Kommunikations-Regulierungsbehörde Ofcom, behaupteten, dass die Zeit des öffentlichen Wertes im Rundfunk vorüber sei und eine neue Zeit des individuellen Wertes und der Wahlfreiheit individueller Verbraucher beginne. Abonnements, Verschlüsselung und andere Formen von Wettbewerb und Ausschluss würden einen perfekten Markt für Programme und Dienste schaffen. Dem gegenüber erklärt sich die BBC überzeugt, „that the potential – and the need – for public value in broadcasting has never been greater. Creating a fully digital Britain is a public challenge which the BBC must help to lead. It is a Britain from which the BBC, and only the BBC, can ensure that no one is excluded.“ (ebd.: 5).
Die BBC sah sich an einem Wendepunkt, am Beginn der „zweiten Phase der digitalen Revolution“. Die erste Phase war bestimmt durch die Umstellung des Antennenfernsehens von analoger auf digitale Signalübertragung (Digital Terrestrial Television (DTT), erstmals im November 1998 gestartet im Standard DVB-T unter dem Markennamen Freeview), die im Oktober 2007 begann und im Oktober 2012 abgeschlossen wurde, sowie die Einführung digitaler Spartenkanäle (BBC 2004: 93). Ferner nennt die BBC ihre Online-Präsenzen. Erste Websites betrieb sie bereits 1995 zur Ergänzung der Berichterstattung über den britischen Haushalt, die Übergabe von Hong Kong an China und den Tod von Lady Diana. Im November 1997 wurde BBC Online offiziell gelauncht, darunter auch BBC News Online. Im Oktober 1998 wurde BBC Online als ein ‘core public service’ genehmigt. Doch auch 2004 waren noch viele Menschen außen vor. Mobiltelefone waren in der letzten Charter kaum erwähnt worden, hätten inzwischen aber erhebliche Bedeutung erlangt.
Die zweite Phase der digitalen Revolution werde gekennzeichnet von Breitbandzugang zu einem unbegrenzten Angebot an Programmen und Diensten und müheloser Kommunikation und Kreation eigener Inhalte. Qualität und Vielfalt der Inhalte würden dann entscheidend sein ebenso, wie neue Wege Menschen zu involvieren (ebd.: 9; 50 ff.).
Unter der Überschrift „Building Digital Britain“ (ebd.: 11; 61 ff.) bekennt sich die BBC dazu, die Digitalisierung von Fernsehen und Radio voranzutreiben, ein „Creative Archive“ zu starten, das die Schätze der BBC allen frei zugänglich macht (ebd.: 63), dem Publikum BBC-Inhalte, wann und wo es möchte, verfügbar zu machen und mit anderen daran zu arbeiten, das Breitband-Internet kostengünstiger zu machen.
Auch in der Bildung sah sich die BBC in nichts weniger als einer Revolution. Sie kündigte neue Bildungskampagnen in allen Medien an, neue personalisierte Formen des formellen und informellen Lernens, sowie Maßnahmen, um die Medienkompetenzen zu erweitern und schwer zu erreichende Zielgruppen anzusprechen (ebd.: 13; 73 ff.). Bei der Förderung der ‘media literacy’ führt sie Bildungsangebote der BBC Open Centres in sechs Städten und die BBC-Multimedia-Lernbusse an, die Computer, Internet und digitale Produktion in lokalen Gemeinden erfahrbar machen (vgl. Rogers 2003), aber auch spezielle Angebote für Über-60-Jährige (BBC 2004: 62; 77).
Das ambitionierteste Projekt war das „BBC Digital Curriculum“, das jede Schule und jedes Kind in Großbritannien erreichen sollte (ebd.: 13; 73 f.). Das Angebot, das Teil eines Plans des Bildungsministeriums war, das weltweit erste umfassende Online-Curriculum mit multimedialen, interaktiven Lernmaterialien in einer virtuellen Lernumgebung zu schaffen, war im Januar 2003 bewilligt worden. Im Januar 2006 wurde das Digital Curriculum unter dem Namen „BBC Jam“ gelauncht. Das Angebot für 5- bis 16-Jährige schloss unmittelbar an das nationale Schulcurriculum an. Im März 2007 musste es eingestellt werden. Grund waren Klagen bei der EU-Kommission von kommerziellen Anbietern von Bildungsprodukten, die durch den kostenlosen Dienst der BBC ihren Markt geschädigt sahen, darunter der Guardian mit seiner inzwischen ebenfalls eingestellten Plattform Learn.co.uk. Auflage des BBC Trust war ohnehin, dass die Hälfte der Inhalte von kommerziellen Anbietern eingekauft werden müssen. Die EU-Kommission befand das Angebot zwar mit dem Beihilferecht vereinbar, doch unter den Vorwürfen, BBC Jam sei nicht ausreichend verschieden von und komplementär zu bestehenden Angeboten, suspendierte es der Trust und orderte die BBC an, neue Pläne zu entwickeln, wie sie ihren Bildungsauftrag erfüllen könne, ohne der Industrie für Bildungssoftware in die Quere zu kommen. Das zeitgleich mit BBC Jam im Januar 2006 gestartete Schulangebot Bitesize hat seither seinen Platz eingenommen.
„Public Value“ ist das zentrale Konzept, das die BBC in ihrem Manifest Building Public Value (2004) neu einführte. Es dient dazu, den Herausforderungen durch die Digitalisierung, dem seit über zehn Jahren anhaltenden Druck, zu sparen und Einnahmen aus kommerziellen Aktivitäten zu erhöhen, sowie den grundsätzlichen Infragestellungen ihrer Existenzberechtigung zu begegnen.
Während kommerzielle Rundfunkanbieter darauf zielten, Wert für ihre Aktionäre zu schaffen, heißt es dort, existiere die BBC ausschließlich, um öffentlichen Wert zu schaffen. Jede öffentliche Organisation müsse nicht nur Individuen einen Wert bieten, sondern auch Bürgern und der Gesellschaft als Ganzes, deren soziales, demokratisches und kulturelles Wohl sie zu fördern habe (ebd.: 28 f.).
Das Konzept „Public Value“ hatte der Harvard-Verwaltungswissenschaftler Mark Moore 1995 vorgestellt. Er formulierte es ausdrücklich gegen das in den 1990er Jahre vorherrschende neoliberale Modell des New Public Management. Dieses legte den Fokus auf individualisierte Leistungen in Bibliotheken, Arbeits- und Sozialämtern an Bürger, die nun „Kunden“ genannt wurden. Demgegenüber tritt bei Moore das öffentliche Interesse in den Vordergrund, das etwas anderes ist, als die Summe der individuellen Interessen. Public Value sei Gegenstand der öffentlichen Aushandlung der kollektiv artikulierten und politisch vermittelten Präferenzen der Bürger. Aufgabe des Public Managers ist es nicht in erster Linie, Ergebnisse zu liefern, sondern als Diplomat einen konsultativen, kooperativen Prozess zu lenken, der alle ‘Stakeholder’ einbezieht und auf eine umfassende Vorstellung von Gemeinwohl zielt. Das Maß seiner Leistung sind nicht nur Resultate, sondern Legitimität, Fairness und Vertrauen (Moore 1995; Moore 2013; vgl. Grassmuck 2014).
Dass die BBC 2004 den Moore’schen Begriff aufgriff, ist umso bemerkenswerter, da zeitgleich in Großbritannien der New Public Management-Ansatz dominierte, gegen den Moore sich gerichtet hatte. Unter der New Labour-Regierung von Tony Blair und Gordon Brown (1997–2010) wurde die Vermarktlichung der staatlichen Kommunikation vorangetrieben. Die ‘Öffentlichkeit’ wurde nun als ‘Publikum’ angesprochen und ‘Bürger’ als ‘Konsumenten’ (Ramsey 2015).
Hintergrund für den Schritt zu Public Value war einerseits die Forderung der EU-Kommission, dass der Auftrag öffentlich-rechtlicher Anstalten präzisiert werden müsse, um dem europäischen Beihilferecht zu genügen, andererseits die wachsende Notwendigkeit, ihre Akzeptanz im Dialog mit ihrem Publikum zu stärken. Folglich heißt es, die BBC „needs utter clarity about its values and about what its owners, the British public, expect from it. It must apply the test of public value to everything it does.“ (BBC 2004: 5).
Ihren Wert für Individuen, Gesellschaft und Wirtschaft teilt die BBC in fünf Bereiche auf: 1. demokratischer Wert, 2. kultureller und kreativer Wert, 3. Bildungswert, 4. Wert für die Gesellschaft und die Gemeinschaften und 5. internationaler Wert (ebd. 29 f.). Sie will zunächst den Umfang und die Ziele ihrer Angebote expliziter als in der Vergangenheit darlegen und sie damit vorab diskutierbar und einer Erfolgsprüfung im Nachhinein zugänglich machen.
Um ihren schwer quantifizierbaren Wert zu ermessen, hat die BBC einen zweistufigen Public Value-Test (PVT) entwickelt, dem künftig alle Angebote unterzogen werden sollen. In der ersten Stufe legt die BBC dar, wie das geplante Angebot zur Erfüllung ihres Auftrags beiträgt und holt in einer öffentlichen Konsultation die Stellungnahmen von Stakeholdern ein. In der anschließenden Stufe stehen quantifizierbarere, vor allem ökonomische Aspekte im Vordergrund. Die Bürger werden befragt, wie viel sie bereit wären, für das neue Angebot zu bezahlen. Das Verhältnis von Investitionen und erwarteten Ergebnissen wird eingeschätzt und ein externes Gutachten prüft die möglichen Auswirkungen des Angebots auf den Markt (ebd.: 83 ff.).
Ob sich der angekündigte Public Value tatsächlich eingestellt hat, will die BBC in den Dimensionen Reichweite, Qualität, Impact und Geldwert empirisch überprüfen und dazu ihre Verfahren zum Sammeln und Analysieren von Daten systematisieren. Ferner soll alle drei bis fünf Jahre eine unabhängige Public Value-Umfrage unter 10.000 Beitragszahlern durchgeführt werden (ebd.: 87 f.).
Bis heute sind fünf PVTs durchgeführt worden. Davon sind die Mediathek (der BBC iPlayer), High Definition TV, der gälische digitale TV-Kanal BBC Alba sowie jüngst eine Reihe Änderungen verschiedener TV- und Online-Angebote genehmigt worden. Abgelehnt wurde ein geplantes lokales Video-Nachrichtenangebot. Der Test für das Digital Curriculum wurde nicht abgeschlossen, da der BBC Trust das Projekt zurückgezogen hatte (Coyle/Woodard 2010).4
Für ihre Verwendung des Public Value-Konzepts ist die BBC kritisiert worden: Sie sei eine Rhetorik ohne Erklärungskraft und Folgen, opportunistisch, habe den radikalen Gehalt von Moores Theorie unterschlagen. Die BBC hält dem entgegen, dass sie Public Value als scharfes Werkzeug einsetze, um zu entscheiden, was die BBC tun und was sie nicht tun sollte. Sie verkürzt den Begriff somit auf den Public Value Test. Bartenberger sieht die Gefahr gerade in einer Umdeutung der Public Value-Theorie zu einem „Instrument der (Selbst)disziplinierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks … eine Einschränkung auf ein konkret abgestecktes Feld, Evaluierung aller Tätigkeiten, kurz: … ein In-die-Schranken-weisen.“ (Bartenberger 2010: 69 f.)
Die Royal Charter von 2007, die im Wesentlichen die Verfasstheit der BBC und ihrer Gremien regelt und ihren Auftrag nur in wenigen Zeilen benennt, wurde erstmals von einem Abkommen zwischen dem Ministerium für Kultur, Medien und Sport und der BBC (DCMS 2006) begleitet, das Auftrag und Verfahrensweisen detaillierter beschreibt und die einzelnen BBC-Angebote in TV, Radio und Internet auflistet. Während die Charter z. B. den Public Value Test nur erwähnt, gibt das Agreement konkrete Ausführungsbestimmungen (ebd.: 11 ff.). Spätestens mit dieser Charter wurde das Internet dem Radio und Fernsehen gleichgestellt. Zentrales Element der Online-Strategie war der zu Weihnachten 2007 vorgestellte BBC iPlayer.
Zwischen den Chartern
Die Zeit der Charter-Erneuerung 2006 und ihr Gefolge war turbulent für das Land und für die BBC. Einige der Probleme der BBC waren hausgemacht. Zudem wehte ihr von der neuen konservativen Koalitionsregierung von David Cameron (2010-2015) ein deutlich kälterer Wind entgegen. Die Vorwürfe, die BBC würde mit ihren Angeboten kommerziellen Medienunternehmen schaden, wurden lauter. 2011 wurde die Höhe des Rundfunkbeitrags eingefroren und die BBC verpflichtet, 20% ihrer Ausgaben einzusparen. Überdies entschied die Regierung, einen Teil des BBC-Etats für den Breitbandausbau zu verwenden. 2011 sah die BBC sich gezwungen, über die kommenden zwei Jahre ihren Online-Etat um 25% auf 103 Millionen Pfund zu kürzen. Dem Spardruck fielen 360 Stellen und 200 Websites zum Opfer, darunter eine ganze Reihe interessanter Projekte (BBC News 24.01.2011).
Im Mai 2003 hatte die BBC einen Bericht ausgestrahlt, in dem der britischen Regierung vorgeworfen wurde, Geheimdienst-Berichte über irakische Massenvernichtungswaffen übertrieben zu haben, die den Kriegseintritt begründet hatten. Als mutmaßliche Quelle wurde der Biowaffenexperte David Kelly identifiziert. Die Regierung stritt die Vorwürfe ab. Kelly musste sich am 15.07.2003 vor dem Außenausschuss des Parlaments rechtfertigen. Zwei Tage später wurde er tot aufgefunden. Daraufhin untersuchte ein Ausschuss unter Lordrichter Brian Hutton die Umstände seines Todes. Den Abschlussbericht im Januar 2004 interpretierte Tony Blair als völlige Entlastung seiner Regierung. Der BBC warf der Bericht jedoch Mängel in ihren redaktionellen und Management-Abläufen vor, woraufhin der Generaldirektor der BBC Greg Dyke, der Intendant Gavyn Davies und der betroffen Journalist Andrew Gilligan von ihren Posten zurücktraten. Journalisten außerhalb der Corporation bezeichneten den Tage der Veröffentlichung als einen der schlimmsten in der Geschichte der BBC.
Einen weiteren Tiefschlag erlitt die BBC im Bereich Technologie. Sie war immer angehalten, die Entwicklung neuer Medientechnologien voranzutreiben. In der aktuellen Charter lautet dieser Auftrag: „The BBC must promote technological innovation, and maintain a leading role in research and development, that supports the effective fulfilment of its Mission and the promotion of the Public Purposes.“ (Royal Charter 2016: 9)
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der BBC war zusammen mit Partnern maßgeblich beteiligt an der Entwicklung von FM-Radio, Farbfernsehen, Digitalfernsehen, DAB, HDTV, Internet-Angeboten, Untertitelung, drahtlosen Digitalkameras usw. Die BBC trug damit jeweils ausdrücklich auch zur Weiterentwicklung des Ökosystems des gesamten Medienmarktes bei (BBC 2004: 41).
2008 startete die BBC ein ambitioniertes Projekt, die gesamte Produktion auf einen digitalen, bandlosen Workflow umzustellen: die Digital Media Initiative (DMI). Der Auftrag dazu wurde an Siemens vergeben, nach technischen Problemen und Verzögerungen aber schon 2009 wieder entzogen. Das Projekt wurde dann in-house weitergeführt mit Kosten von 98 Millionen Pfund zwischen 2010 und 2012. Doch auch hier litt das Projekt an mangelhaftem Management, geringen Ressourcen und einer zu optimistischen Planung, die von der technischen Entwicklung überholt wurde. Wo die BBC anfangs auf Eigenentwicklungen setzte, entstanden nach und nach Standard-Anwendungen für einen digitalen Workflow.
Nachdem der BBC Trust schwerwiegende Bedenken gegenüber der DMI anmeldete, wurde eine interne Untersuchung durchgeführt, die ergab, dass das Projekt kaum etwas vorzuweisen hatte. Die Berichterstattung über den Tod von Margaret Thatcher im April 2013 machte die Engpässe bei Digitalisierungsstationen deutlich. Videobänder mussten per Taxi und U-Bahn durch London transportiert werden, um sie von externen Dienstleistern digitalisieren zu lassen. Weitere Engpässe gab es bei der Einspeisung der Digitalisate in das Content Management System der BBC.
Daraufhin entschied BBC-Generaldirektor Tony Hall im Mai 2013, die DMI einzustellen, den Technologiedirektor John Linwood zu entlassen und eine unabhängige Untersuchung einzuleiten, um festzustellen, was genau schief gelaufen sei. Dieser Bericht stellte neben Managementfehlern und der Komplexität des Projektes als Ursache für sein Scheitern fest, dass es zwar Technologie entwickelt, sich jedoch nicht ausreichend für ihre Integration in die Arbeitsprozesse im Unternehmen engagiert habe (PWC 2013).
BBC on-demand und Archive
Eine Erfolgsgeschichte hingegen ist das populärste öffentlich-rechtliche On-Demand-Angebot der Welt: der BBC iPlayer. Eine erste Version unter dem Namen „Integrated Media Player“ war 2003 vorgestellt worden. Eine Weiterentwicklung wurde 2005 in „MyBBCPlayer“ umbenannt bis im Dezember 2007 der heutige iPlayer folgte (Ramsey 2016: 6 ff.). Der Etat betrug 3,9 Millionen Pfund im Jahr, wobei die Kosten für die Inhalte von jenen Abteilungen getragen wurden, die sie ursprünglich gesendet haben.
Die Verweildauer für die meisten Programme im iPlayer wurde von anfangs 7 auf heute 30 Tage verlängert. Einige Programme stehen für weniger als 30 Tage bereit, andere, darunter aktuelle Sendungen, für ein Jahr, Bildungsprogramme bis zu fünf Jahre. Mit Hilfe von Digitalem Rechte-Management (DRM) löschen sich heruntergeladene Dateien nach Ablauf der Frist. Der Einsatz von DRM in einem öffentlich-rechtlichen beitragsfinanzierten Angebot führte zu Protesten der Initiative Defective by Design im August 2007 und erneut im Dezember 2008. Die BBC verteidigte ihre Entscheidung damit, dass es zwei Jahre gebraucht habe, die Rechteinhaber dazu zu bekommen, einer kostenlosen Verbreitung über das Internet überhaupt zuzustimmen. DRM sei die Bedingung dafür gewesen (Backstage-Blog 14.08.2007). Für die Programme auf der iPlayer-Website ist der Zugriff zudem per Geoblocking auf Großbritannien beschränkt.5 Die iPlayer-App wird in deutschen App-Stores nicht mehr angezeigt. Im britischen iOS-App-Store kann man sie aber nicht mit einer deutschen Apple-ID herunterladen. Als Grund für beide Beschränkungen gibt die BBC Kostenabwägungen an: Rechte für längere Zeit und mehr Territorien zu erwerben wäre entsprechend kostspieliger.
Der erste Review des iPlayers im Jahr 2010 mit Stellungnahmen der Audience Councils und Industrieverbände sowie einer Konsultation mit 9.000 Eingaben ergab, dass das On-Demand-Angebot in der Zielgruppe von 16 bis 34 Jahren erfolgreich war, während Simulcasts und Podcasts nicht in dem Umfang angenommen wurden wie erwartet. Live-Streaming des linearen Programms scheitert oft an mangelnder Bandbreite. Die 7-tägige ‘Catch-up’- Zeit wurde als zu kurz kritisiert. Programme von BBC Three und Four wurden im Vergleich zu ihrer linearen Reichweite besonders häufig im iPlayer nachgefragt. Viele Zuschauer haben im iPlayer Programme entdeckt, von denen sie noch nie gehört hatten (BBC Trust 2010).
Über die aktuellen Sendungen hinaus strebt die BBC an, möglichst viele Inhalte aus ihren Archiven öffentlich zugänglich zu machen. Das BBC-Archiv ist mit über 12 Millionen Archivalien eines der größten Rundfunkarchive der Welt. Es reicht zurück bis 1890 und umfasst zahlreiche Sammlungen von TV- und Radiosendungen, Texten, Fotos, Noten, Kulturerbe usw. (vgl. Berger 2012). Die Digitalisierung sämtlicher BBC-Programmhefte wurde im Dezember 2012 abgeschlossen. Die Archivgruppe bezeichnet dies als „BBC-Genom“, da die Programmpläne erlauben, die noch existierenden sowie sie fehlenden Aufnahmen zeitlich zu erfassen. Große Teile des Medienarchivs sind inzwischen digitalisiert. Historische Materialien wurden zunächst auf einer BBC Archive-Website präsentiert, sind inzwischen jedoch in den iPlayer integriert.
Ebenfalls 2007 ging BBC Redux in Betrieb, das System, das sämtliche landesweit ausgestrahlten BBC TV- und Radiosendungen automatisiert aufzeichnet. Bis 2012 wurde der Zugang zu diesem Sendearchiv auch temporär für Hack Days und andere Entwicklerveranstaltungen freigeschaltet. Heute ist es nicht mehr öffentlich zugänglich und wird zur Wahrung der presserechtlichen Aufbewahrungsfristen und für die BBC-internen Programmforschung und -Recherche verwendet, aber auch als Testbett, um Verfahren für Klassifizierung, Empfehlungssysteme, Stimmungs-basierte Navigation u.ä. zu entwickeln.
Während Webseiten anderer Öffentlich-Rechtlicher regelmäßig innerhalb kürzester Zeit wieder verschwinden, archiviert die BBC konsequent sämtliche Webseiten und hält sie nachhaltig zugänglich.
Das in der Charter-Erneuerung 2006 angekündigte Creative Archive war wiederum von kurzer Dauer. Bereits 2005 hatte die BBC zusammen mit dem British Film Institute, der Open University, Channel 4 und dem privaten, vom Bildungsministerium geförderten Teachers’ TV die Creative Archive Licence (CAL) entwickelt, eine von Creative Commons inspirierte Freilizenz. Sie beschränkt die Weiternutzung des lizenzierten Werkes auf nichtkommerzielle Zwecke, erlaubt es, abgeleitete Werke daraus zu erstellen und schreibt vor, dass diese unter derselben Lizenz veröffentlicht werden müssen und dass der Urheber, z. B. die BBC, genannt werden muss. Anders als die CC-Lizenzen verlangt die CAL, dass ihr Logo am oder im Werk angebracht wird und verbietet, dass das Werk oder eine Ableitung davon in einer Weise verwendet wird, die eine Billigung oder Unterstützung durch die BBC suggeriert, sowie für illegale, herabwürdigende, anstößige Zwecke, aber auch für politische oder wohltätige Kampagnen. Schließlich ist – als Logo und Anweisung, nicht aber im Lizenztext selbst – hinzugefügt worden, dass die Lizenz nur in Großbritannien gültig ist.
Im Rahmen des Pilotprojekts BBC Creative Archive stellte die BBC ab 2005 etwa 500 TV- und Radiobeiträge, vor allem Nachrichten und Naturdokumentationen, registrierten Nutzern in UK zur kreativen Weiterverwendung zur Verfügung. Dazu gab es Ideen und Werkzeuge für die Bearbeitung. Einer der Höhepunkte war das Open Earth Archive, das mit einem eigens dafür geschaffenen Preis für „Interaktive Innovation“ auf den British Academy Television Craft Awards ausgezeichnet wurde. Nach einem Review durch den BBC Trust im Jahr 2006 wurde das Pilotprojekt abgeschlossen.
Zum Abschluss des Projektes zog der Filmemacher und Medienkompetenz-Vorreiter David Puttnam ein Resume: Angesichts der wachsenden Meinungsdominanz von Internet-Giganten wie Google und Facebook sei es wichtig, dass Initiativen wie das Creative Archive dem öffentlichen Interesse im Internet dienten. Puttnam forderte ein Umdenken in Bezug auf Urheberrechte. Wäre es nach der Filmindustrie gegangen, hätte sie sich weiter gegen die Verbreitung ihrer Produkte im Fernsehen, auf VHS und DVD gewehrt, also genau den Kanälen, die das Überleben des Kinos ins 21. Jahrhundert gesichert hätten. Stattdessen müsse das Ziel sein, den öffentlichen Zugang zu audiovisuellen Materialien zu maximieren. Wie Bücher sollten sie in öffentlichen Bibliotheken bereitgestellt werden.
„The Creative Archive License Group exists to ensure public access to public archives is optimised in the digital age. It’s quite simple, we all pay for the upkeep of the material in these archives – we should all be able to access them. If we are unable to access most, if not all, of the riches locked up in these treasure troves, then it quite naturally begs the question, ‘why are [we] paying for them to be preserved in the first place’?“ (Puttnam 2006).
Anschlussprojekte, bei denen Archivmaterialien für Bildungszwecke oder Remixing frei lizenzenziert wurden, gab es nicht. Auch die anderen Mitglieder der CAL Group stellten die Verwendung der Lizenz ein, setzen aber natürlich ihre Open Access-Strategie mit anderen Mitteln fort (z. B. die Open University). Auch führt die BBC die Partnerschaften mit der Open University, Museen, Bibliotheken und Archiven weiter, z. B. im aktuellen Ideas-Projekt (s. u.).
2007 folgte ein geschlossener sechsmonatiger BBC Archive Trial mit 20.000 Personen. Hier ging es um die Frage, welche alten Programme sie in welcher Form sehen möchten. Doch Ashley Highfield, BBC Director Future Media and Technology, machte deutlich, dass es sich beim Archivzugang um ein langfristiges, komplexes Unterfangen handele. Dabei müsse auch der richtige Finanzierungsmix aus Beiträgen und Markterlösen gefunden werden (Highfield 2007).
Bildung
1995 hatte die BBC ihre Bildungsangebote in der BBC Learning Zone zusammengefasst. Dazu gehörten die Sendungen der Open University zur Vorbereitung auf Hochschulabschlüsse und zur Allgemeinbildung, von BBC Schools sowie die Sprachlehrprogramme BBC Languages. 1997 wurde die Learning Zone unabhängig von BBC Two und in deren Sendepause von den frühen Morgenstunden bis um 6 oder 7 Uhr ausgestrahlt. Zusätzlich wurden die Programme auf VHS und später DVD verbreitet, aufgrund von Urheberrechten jedoch nur wenige davon on-demand im iPlayer.
Für Kinder hatte die BBC 2002 die beiden neuen TV-Kanäle CBeeBies für unter-6-Jährige (s. a. CBeeBies für Erwachsene) und CBBC für 6- bis 12-Jährige gestartet. Beide sind heute auch im Web und im iPlayer verfügbar (vgl. den ersten Review of services for children (2009) und den zweiten Review (2013)).
Bitesize bietet seit 2006 Online-Schulfernsehen für alle Jahrgangsstufen. Das Angebot der formellen Bildung wird von 62% der Grundschüler und 82% der Sekundarschüler genutzt (BBC 2015: 37).
2007 fasst die BBC ihre Jugendangebote für 12- bis 17-Jährige in TV, Radio und online unter dem Namen BBC Switch zusammen. Die Marke einschließlich des Internet-Portals wurde schon 2010 aufgrund der Kürzung des Online-Etats wieder eingestellt (vgl. den Review of services for younger audiences (2009)).
Zur Wissenschaftsvermittlung an ein junges Publikum dient Terrific Scientific, darunter auch die Live Lessons. Get Inspired will junge Menschen für Sport begeistern. Sport-bezogene Wissenschaftsfragen behandelte iWonder, das inzwischen ebenfalls eingestellt wurde. Die 2014 archivierten Seiten von BBC Learning zeigen, wie breit das Angebot einmal war.
Die TV-Ausstrahlung von Kursmaterialien der Open University wurden im Dezember 2006 eingestellt. Im Sommer 2012 endeten auch die Sprachprogramme. Schließlich kündigte die BBC an, dass sie aufgrund von Haushaltskürzungen die BBC Learning Zone zum Juli 2015 vollständig einstellen werde. Seither finden die Bildungsangebote der BBC außer in den TV-Kanälen CBeeBies und CBBC nur noch im Internet statt.
Die Open University (OU) produziert seit 2006 weiterhin akademische und dokumentarische Rundfunkprogramme vor allem für BBC Four. Ihre curricularen Angebote präsentiert sie seither auf der eigenen Website OpenLearn und seiner Plattform für MOOCs (Massive Open Online Course) FutureLearn sowie auf Apples iTunes U und auf einem Youtube-Kanal. Mit OpenLearn hat sich die OU der Open Educational Resources (OER) Bewegung angeschlossen. Eine wachsende Zahl von Materialien steht unter einer Creative Commons BY-NC-SA Lizenz, die nicht nur Herunterladen und Weitergeben, sondern auch ihre Veränderung erlaubt.
Von der Learning Zone ist online ein Platzhalter für Sendungen geblieben, die für die Learning Zone produziert worden waren und für fünf Jahre online verfügbar gemacht werden, hier und auf den Sites von CbeeBies, CBBC und BBC Four. Für mehr Informationen über die neue Vision für Bildungsfernsehen verweist die Seite auf das Blog von Katy Jones, seit 2011 Executive Producer BBC Learning. Dort finden sich zwischen 2012 und 2014 ganze vier Einträge.
CbeeBies und CBBC unterstehen der BBC Children’s Division, die Teil der Home Entertainment Division von BBC Worldwide ist, dem kommerziellen Arm der BBC, der Rechte an BBC-Produktionen international vermarktet. Neben Produktion, Lizenzgeschäft und Shop betrieb BBC Worldwide elf Kanäle, darunter außer CBBC und CbeeBies auch BBC Knowledge und BBC Earth.
Ab 1999 gab es einen digitalen TV-Kanal namens BBC Knowledge mit den Schwerpunkten Kultur, Bildung und Dokumentation, der 2002 eingestellt und durch BBC Four ersetzt wurde. Unabhängig davon startete BBC Worldwide 2007 unter demselben Namen BBC Knowledge einen TV-Kanal ähnlichen Zuschnitts zur Verbreitung in Asien, Pazifik, Italien, Türkei usw. Über das Internet ist er nur in Australien und Neuseeland zu sehen (Wikipedia). 2014 wurde angekündigt, dass in den meisten Territorien ein neuer Kanal, BBC Earth, mit Schwerpunkt auf Naturdokumentationen an seine Stelle treten soll.
UGC, Medienkompentenz, Talentförderung, Aus- und Fortbildung
Neben formellen und informellen Bildungsangeboten für Kinder, Schule und Hochschule richtet die BBC sich auch auf Berufsbildung und allgemeine Medienkompetenz.
Das 2002 gestartete BBC Blast diente dazu, 13- bis 19-Jährige bei der Entfaltung ihrer Interessen an Film und Musik, Kunst und digitaler Kreativität zu unterstützen. In einem Forum konnten Teilnehmer eigene Videos, Audios und Bilder hochladen und kommentieren. Workshops und andere Events waren Teil der Medienkompetenz-Förderung, in die neben professionellen Medienmachern als Mentoren auch Lehrer einbezogen wurden. Schulen erhielten ein Blast Creative Toolkit. Zu den Partnern von Blast gehörten das Victoria and Albert Museum, Zoo Nation und das British Film Institute. 2011 fiel BBC Blast der Kürzung des BBC-Online-Etats zum Opfer.
Nach den Vorwürfen gegen die BBC im Hutton-Bericht über den Tod des Waffenexperten Kelly gab die BBC 2004 eine eigene Untersuchung in Auftrag. Dieser Neil-Report empfahl eine Reihe Reformen, in dessen Zentrum die Einrichtung einer Journalismus-Hochschule stand. Daraufhin wurden im Juni 2005 das BBC College of Journalism mit E-learning-Kursen und im Dezember 2009 die umfassendere BBC Academy eröffnet. Ihre Angebote in den Bereichen Journalismus, Produktion, Technik und Management richten sich an angehende und praktizierende Rundfunkmitarbeiter in und außerhalb der BBC, aber auch an die Öffentlichkeit. Das Angebot gibt es in zahlreichen Sprachen. Viele der Videos sind aber ausschließlich in der iPlayer-App zu sehen.
Mit wenigen Ausnahmen wie BBC Blast erlaubt die BBC ihren Nutzern nicht, eigene Inhalte hochzuladen. Sogenannter User Generated Contet (UGC) spielt aber eine Rolle im BBC-Newsroom. Im UGC-Hub monitoren Journalisten soziale Medien auf nachrichtenrelevante Informationen hin, verifizieren sie, kontaktieren die Urheber, suchen nach Augenzeugen. Smartphone-Aufnahmen von Ereignissen wie den Angriffen in Paris im Januar 2015 werden inzwischen regelmäßig zu zentralen Elementen der Berichterstattung (Natalie Miller, BBC UGC Hub, in einem Beitrag der BBC-Academy).
BBC Backstage war ein Entwickler-Netzwerk für Freie Software, das der BBC-Innovations-Chef und der Projektdirektor Web 2.0 im Mai 2005 gelauncht haben. Ziel war es, innovative Anwendungen zur Weiternutzung von BBC-Inhalten und Daten zu fördern. Ging es beim Pilotprojekt mit der Creative Archive Licence um die Schaffung neuer Werke, stand hier die Entwicklung von Software im Vordergrund, die z. B. TV- und Radio-Programminformationen, Verkehrsinformationen oder Nachrichten auf neue Weisen auswertet und präsentiert. Die Website bot verschiedene APIs zu Diensten und Inhalten der BBC. Im Rahmen von Backstage fanden eine Reihe Hackdays und BarCamps statt. Projekte und Prototypen wurden auf einem Blog veröffentlicht und diskutiert. 2006 zeichnete der New Statesman Backstage mit dem New Media Award aus. Im Dezember 2010 wurde Backstage eingestellt, nicht aus Spargründen oder weil es gescheitert wäre, sondern im Gegenteil, weil es so erfolgreich war. Der Produzent erklärte zum Abschied, die Backstage-Herangehensweise habe sich wie ein Lauffeuer durch die BBC verbreitet und habe sie für immer verwandelt. Ingenieure, Forscher und Programmmacher sprächen heute täglich über verrückte Ideen, die noch fünf Jahre zuvor sofort abgeschossen worden wären (Ian Forrester 26.01.2011). Projektleiter Adrian Woolard sah die Hackday-Phase als abgeschlossen an. Der Geist von Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit mit externen Entwicklern habe sich nun in der BBC durchgesetzt. Zu den bleibenden Ergebnissen von Backstage gehörte auch ein Server, auf dem interne Entwickler mit Prototypen experimentieren können, ohne Gefahr, gleich das ganze BBC-Netz in die Knie zu bringen (Guardian Tech Blog, o.D.).
BBC digitale Bildung: Hardware und Breitband
Ein besonderer Schwerpunkt der BBC liegt auf der Informatik-Bildung, unterstützt durch Hardware-Entwicklung und einen Beitrag zum Breitbandausbau des Landes.
Schon in den frühen 1980er-Jahren startete die BBC das BBC Computer Literacy Project. Dafür benötigte sie einen Computer in möglichst vielen Schulen und Haushalten, auf dem die Zuschauer im Rahmen einer Fernsehserie Programmieren lernen sollten. Die BBC formuliert ihre Anforderungen an den Computer und sandte sie an verschiedene Hersteller. Den Zuschlag erhielt Acorn. Der BBC Micro (1981) wurde in 70% der Schulen des Landes eingesetzt, hatte einen Marktanteil von 60% in UK und verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal.
Die BBC hatte den BBC Micro an Schulen verteilt, aber auch viele Privathaushalte kauften den damals fortschrittlichen Computer mit BBC BASIC im ROM. Ab Februar 1982 wurde die 10-teilige Serie „The Computer Programme“ ausgestrahlt, begleitet von einem Buch, einer Auswahl an Programmen und einem BASIC-Programmierkurs des National Extension College. 1986 brachte Acorn das Nachfolgemodell, den BBC Master heraus (vgl. Allen 2015). 2012 hatte die BBC ein weiteres Computer Literacy Project geplant, jedoch abgebrochen.
2015 folgt dann die nächste große „Flagship-Initiative“ Make it Digital (BBC PM 02.10.2015). Hintergrund war die Erkenntnis, dass über die kommenden fünf Jahre 1,4 Millionen Programmierer und andere IT-Spezialisten in UK fehlen würden. Dafür konzipierte die BBC erneut einen eigenen Computer, diesmal ein Kleinstmodell, den BBC micro:bit, jetzt bevorzugt mit der Programmiersprache Python. Mit Partnern zusammen gründete sie die Micro:bit Educational Foundation, um den Rechner weiter zu entwickeln und zu vertreiben. Im Rahmen von Make it Digital erhielt jedes Kind in der 7. Klasse (11-12 Jahre) einen Micro:bit, eine Million davon wurden verschenkt.
BBC Learning produziert weiterhin Inhalte und Projekte auf dem Micro:bit, darunter die Micro:bit Robot Wars und die Doctor Who and the micro:bit – Live Lesson am 28.03.2017.
Dass sich die BBC neben der Entwicklung von Bildungs-Hardware auch für den Breitbandausbau des Landes engagiert, mag verwundern, ist jedoch nur folgerichtig. Je mehr Angebote die BBC ausschließlich online verbreitet, desto wichtiger wird es aufgrund ihrer Universalverpflichtung, dass alle Haushalte in der Lage sind, diese Angebote auch abzurufen.
Der nationale Breitbandplan Broadband Delivery UK sieht 2 Mbps flächendeckend bis Ende 2015 und 24 Mbps für 95% der Haushalte bis Ende 2017 vor. Als die konservative Koalitionsregierung von David Cameron 2010 ins Amt kam, beschloss sie, auch BBC-Beitragsmittel zur Erreichung der Breitbandziele zu verwenden. 2012 wurde entschieden 300 Millionen Pfund für die Jahre 2015 bis 2017 dafür zu verwenden (ISP-Review 10.08.2012).
Diese Förderung soll nun auslaufen. Im Agreement zwischen dem Ministerium für Kultur, Medien und Sport und der BBC, das zusammen mit der BBC-Charter im Dezember 2016 verabschiedet wurde, wird bestimmt, dass die BBC für den Breitbandausbau im Haushaltsjahr 2017/18 noch einmal 80 Millionen Pfund beisteuert, 2018/19 dann 20 Millionen und 2019/20 die letzten 10 Millionen Pfund.
BBC Three
Der erste britische digitale Kabel- und Satellitensender war das 1998 gestartete BBC Choice.6 Der Schwerpunkt lag auf Unterhaltung, Sport, Dokumentationen und Wiederholungen populärere Sendungen auf BBC One und Two („Pick of the Week“). 2003 wurde Choice eingestellt und ersetzt durch BBC Three. Dessen Auftrag lautete, sich an 16- bis 34-Jährige zu richten. Im Februar 2016 war es der erste öffentlich-rechtliche Fernsehsender, der zugunsten eines reinen Online-Angebots eingestellt wurde.
2008 war das Internet integraler Teil der BBC-Angebote geworden und BBC Three wurde trimedial: Alle Inhalte aus TV und Radio wurden nun auch im Internet angeboten, live und on-demand (s. der damalige BBC Three-Controller Danny Cohen zum Relaunch, 22.01.2008). Zum zehnjährigen Geburtstag erklärte Zai Bennett, der Controller des mehrfach preisgekrönten Angebots, dass es sich um den Digitalkanal mit den meisten Zuschauern in England handele. Kein anderer Kanal für junge Erwachsene produziere mehr Dokumentarfilme, Nachrichten und Comedy. Mit einem Etat von 110 Millionen Euro erreicht der Kanal 29% der 16 bis 34-Jährigen.
Im März 2014 gab BBC-Intendant Tony Hall bekannt, dass der trimediale Jugendkanal ab Herbst 2015 nur noch online im BBC iPlayer weiter geführt werde. Grund waren erneut radikale Budgetkürzungen. Der digitalen BBC Three soll nur noch die Hälfte ihres vorherigen Etats bleiben. Prompt führte die angekündigte Schrumpfkur zu Protesten von Bildschirmstars und einer Petition zur Erhaltung von BBC3 mit mehr als 260.000 Unterschriften. Auf 25 Millionen Euro soll der Etat des neue BBC Three schrumpfen und dennoch, wie Projektleiter Damian Kavanagh erklärte, das, was großartig an der BBC ist, mit dem zusammenführen, was großartig am Digitalen ist.
Das neue Programm soll auf zwei Säulen stehen: „Make me think“ (Schauspiel, Dokumentation, Nachrichten und Aktuelles) und „Make me laugh“ (Comedy). Es soll nicht nur die Online-Version eines TV-Kanals sein, sondern Experimente mit Ideen, Talenten und Technologie wagen, um die Youtube-Generation anzusprechen. Das Publikum soll das redaktionelle Angebot mitgestalten können. Inhalte sollen auf allen großen sozialen Netzwerken veröffentlich werden (BBC 2015a).
Der Schritt ins Netz wirft verschiedene Fragen auf. Ramsey (2016) weist darauf hin, dass der Anteil von BBC Online am Beitragsaufkommen 2014 bei nur 5% lag, gegenüber 66% für TV. Das neue BBC Three solle aber aus dem TV-Etat finanziert werden und seine Langformate auch auf BBC One zeigen. Gleichwohl werden Beitragszahler mit einer TV-Lizenz aber ohne Internet-Zugang von einer wachsenden Zahl von Inhalten ausgeschlossen. Umgekehrt benötigte bislang keine TV-Lizenz, wer im Netz nur den Catch-up-Dienst, nicht aber den Live-Stream nutzt. Vor allem beklagt Ramsey das Fehlen einer umfassenderen Digitalstrategie der BBC. Nach der Logik, dass jüngere Publika sich überwiegend im Netz informieren – die er empirisch nicht bestätigt findet –, müsste BBC Four als nächstes online-only werden (Ramsey 2016).
Im Februar 2016 ist das online BBC Three gestartet. Auch wenn es kein freiwilliger Schritt war, zeigt er die Prioritäten: TV und Radio sind als Verbreitungswege für die jungen Zielgruppen unwichtiger geworden.
Charter-Erneuerung 2016: die BBC als offene Plattform
Steht die Erneuerung der Charter der BBC bevor, beteiligen sich Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien breit und leidenschaftlich an der Diskussion. Die Charter 2006 schrieb mit ihren Audience Councils die Einbeziehung der verschiedenen Perspektiven der Beitragszahler in den vier Nationen England, Schottland, Wales und Nord-Irland in alle programmlichen Entscheidungen einschließlich der Public Value Tests vor (Royal Charter von 2007: 14 ff.). Das neu eingeführte Public Value-Paradigma selbst fordert Konsultationen und eine öffentlichen Aushandlung des Auftrags der BBC. Vor allem aber hat die 1983 von der Journalistin Jocelyn Hay gegründete zivilgesellschaftliche Initiative Voice of the Listener & Viewer dazu beigetragen, dass eine Kultur der Partizipation gewachsen ist. Nicht zuletzt betont die BBC immer wieder, dass die Beitragszahler ihre Besitzer seien.
Bei der jüngsten Charter-Erneuerung hat die Konsultation über das Konzept der BBC über 190.000 Eingaben erhalten (Guardian 04.02.2016). Parallel dazu startete die unabhängige Medienplattform openDemocracy die Initiative Our Beeb. The Future of the BBC. Dazu lud sie Künstler wie Brian Eno und Chimene Suleyman, Autoren wie Ian McEwan und Cory Doctorow, Akademiker wie Allyson Pollock und Des Freedman und andere öffentliche Intellektuelle ein, 100 ideas for the BBC beizutragen.
Die Charter-Erneuerung begann mit einem Green Paper zu Zukunft der BBC des Medienministeriums DCMS. Bei seiner Vorstellung am 16.07.2015 sagte Minister John Whittingdale, der Umfang der BBC sei in den vergangenen zehn Jahren exponentiell gewachsen. Es sei Zeit zu fragen “whether this particular range of services best serves licence fee payers” (Guardian 16.07.2015). Zwanzig Jahre zuvor betrieb die BBC zwei TV-Kanäle und fünf nationale Radiostationen. Aktuell war sie mit neun TV-Stationen, zehn nationalen Radiostationen und einer umfangreichen Online-Präsenz mit dem iPlayer, den HbbTV (red button) Angeboten und zahlreichen Websites das größte öffentlich-rechtliche Medium weltweit.
Neben dem Auftrag gehörten zu den Herausforderungen, die das Green Paper aufrief, Kostenreduktion und das Finanzgebaren der BBC, worunter Intransparenz, hohe Gehälter und Abfindungen führender Mitarbeiter und die in der Digital Media Initiative verlorenen 100 Millionen Pfund genannt wurden, die Modernisierung der Licence Fee und Struktur und Regulierung. Aber auch die Attraktivität der BBC für ein junges Publikum nannte Whittingdale weiterhin als Problem (Guardian 16.07.2015).
Die Strukturfragen richteten sich vor allem auf den in der Charter 2006 eingeführten BBC Trust. Alle, vom Rechnungshof über das Ministerium, die Industrie und Akademiker bis hin selbst zur Vorsitzenden des Trusts, Rona Fairhead, waren sich einig, dass es sich um eine Fehlkonstruktion handelte, da es Leitung und Aufsicht der BBC in einem Gremium vereinte (Hughes 2015). Eine unabhängige Untersuchung durch den ehemaligen Vize-Präsidenten der Bank of England, Sir David Clementi, die im März 2016 vorgelegt wurde, empfahl, den Trust durch ein einheitliches Direktorium zu ersetzen, das den Beitragszahlern gegenüber für die Erfüllung des Auftrags der BBC verantwortlich ist. Die Aufsicht über die BBC solle der Kommunikations-Regulierungsbehörde Ofcom übertragen werden, die bereits die Marktauswirkung im Rahmen der Public Value-Tests zu überprüfen hatte (Guardian 01.03.2016). Und so ist es gekommen. Am 02.04.2017 trat an die Stelle des BBC Trust das neue Direktorium unter Vorsitz von David Clementi.
Die BBC reagierte verärgert über die ungwohnt undiplomatische Sprache im Green Paper der Regierung. BBC Generaldirektor Tony Hall erinnerte daran, dass die BBC nicht Eigentum der Mitarbeiter oder von Politikern ist, sondern der Öffentlichkeit. „Sie sind unsere Shareholder. Sie bezahlen den Rundfunkbeitrag. Ihre Stimme sollte am lautesten gehört werden.“ (Radiotimes, 16.07.2015).
„British, Bold, Creative“
Im September 2015 legte dann die BBC im Rahmen der Charter-Erneuerung ihre Strategie für die nächsten zehn Jahre unter dem Titel British, Bold, Creative (BBC September 2015) vor. Darin identifizierte die Corporation als ihre vorrangige Aufgabe, die BBC fit für das Internet zu machen, für eine Internet-only Welt, die sie schon Mitte des kommenden Jahrzehnts für möglich hält. (ebd.: 58)
Der Generationenabriss stellt sich in UK etwas weniger dramatisch als in Österreich und Deutschland dar. Die 16- bis 24-Jährigen schätzten die BBC-Angebote fast genauso sehr wie der Altersdurchschnitt des Landes. BBC One habe in dieser Altersgruppe eine Wochenreichweite von 53%. Alle BBC-Angebote zusammen erreichten sogar 94% von ihnen, allerdings nur mit einer knappen Viertelstunde pro Woche (im Vergleich zu Youtube mit 60% und Netflix mit nur 15%). Gleichwohl zeigt die Entwicklung einen deutlichen Rückgang des TV- und besonders des BBC-Konsums. Daher sieht die Ofcom eine wachsende Spaltung zwischen Jung und Alt. Damit die BBC ihren Auftrag weiterhin erfüllen kann, benötige sie die Freiheit zu Innovationen, besonders im Internet (BBC 2015: 44 f.).
„The internet age strengthens the case for the BBC and its enduring role. In the internet era it is easier to find information but harder to know whether to trust it. It is easier to find small communities but harder for the nation to speak to itself and to the world. It is easier to make content but harder to find the financial support for high-quality work. And the internet age is great for those who can afford it and access it – but those that can’t risk being left on the margins of society.“ (ebd.: 6)
Auch mit den neuen Mitteln des Internet soll die klassische, von Reith etablierte Trias erfüllt werden: zu informieren, zu bilden und zu unterhalten. Dem fügt die BBC nun eine vierte Mission hinzu: „to enable. We want to open the BBC to be Britain’s creative partner, to become a platform for this country’s incredible talent.“
War die Vision in der Charter-Erneuerung 2006 noch „a more open BBC“ (BBC 2004: 19; 110), lautet sie 2016 uneingeschränkt: „An Open BBC“ (BBC 2015: 57 ff.). Die Corporation bekennt, dass sie traditionell nicht offen gewesen sei, für Inhalte von anderen oder für Feedback von ihren Zuschauern. Vielmehr habe sie Programme produziert und an die Nation ausgestrahlt. Sogar die selbst gewählte Symbolik der BBC spiegele diese Mentalität wieder: ‘Broadcast’ sei ein altes Wort für das Ausstreuen von Saatkörnern. „This very idea – the idea of the BBC as simply a broadcaster, one that sends information out to its audiences and does not get any back – must be revisited.“ (ebd.)
Daher will die BBC in einem „fundamentalen Wandel der Herangehensweise“ (ebd.: 59) künftig mit Partnern zusammenarbeiten: mit britischen „Ideeninstitutionen“ Museen, Theatern, Universitäten, mit lokalen Tageszeitungen und anderen Wettbewerbern und vor allem mit dem Publikum, das bei Citizen Science und Produkttests einbezogen und zu Kreativität auch mit BBC-Inhalten ermuntert werden soll und das sie um Rat fragen will, wie die BBC zu betreiben ist.
Für diese Partnerschaften strebt die BBC offene Plattformen an. Im Augenblick würden die BBC-Apps und Websites noch Inhalte rundfunken. Offene Plattformen wie Wikipedia hingegen seien Orte, die zahlreichen Produzenten und Nutzern erlauben, zu interagieren und Wert für einander zu schaffen. Damit sei nicht gemeint, Youtube zu wiederholen oder zu erlauben, dass professionelle Inhalte von User Generated Content überwältigt würden. Vielmehr gehe es um kuratierte Angebote in bester Qualität von professionellen Partnern. Das Papier kündigt an, dass die BBC ihren iPlayer für die Inhalte Dritter öffnen wird. Ob dieses Abrufangebot in der DRM-geschützen Umgebung der iPlayer-App, deren Broadcast-Charakter die BBC selbst bemängelt, Grundlage für die neuen offenen Plattformen wird, oder ein neuer Weg eingeschlagen werden soll, wird nicht recht klar.
Nutzer sollen auf BBC Taster neue Dienste testen können. Durch Personalisierung und Empfehlungen soll ihnen die Navigation erleichtert werden (ebd.: 59 ff.). Im Zentrum der Pläne für eine offene Plattform steht der neue „Ideas Service“.
Der Ideas Service
„In the 20th century, Britain created the World Service, a democratic gift to the world. In this century, building on the wealth of British knowledge and culture, we should offer the world another gift of similar value: the Ideas Service.“ (BBC 2015: 70).
Die BBC unterscheidet zwischen inländischen Angeboten, deren Zugriff mit Hilfe von Geoblocking auf UK beschränkt wird, und ihren internationalen Angeboten, die von BBC Worldwide, dem kommerziellen Arm der BBC, betrieben werden. Der BBC World Service sei das wichtigste kulturelle Exportprodukt Großbritanniens. Vor allem die BBC World News würden das Vertrauen von Millionen in aller Welt genießen. Bis 2022 will die BBC 500 Millionen Menschen weltweit erreichen, um mit den führenden globalen Medienunternehmen mithalten zu können (BBC 2015: 67).
Der Ideas Service soll nun diese Rolle der BBC als Botschafterin der UK in der Welt stärken. In Zusammenarbeit mit den genannten Wissensinstitutionen will die BBC eine Online-Plattform errichten, die den Goldstandard in Genauigkeit, Breite, Tiefe, Debatte und Enthüllung bietet. Was das Publikum an Radio-, TV- und Online-Angeboten der BBC liebt und schätzt, soll nun online zu mehr als der Summe der Teile zusammen geführt werden. Die eigenen Inhalte und die professioneller Partner sollen einer „starken Kuratierung“ durch eine Kombination von redaktionellen, algorithmischen und sozialen Verfahren unterzogen werden.
Partnern will die BBC ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, Zugang zum BBC-Archiv, Aufträge für große Initiativen und kreative und technische Expertise. Der Ideas-Dienst wird über einen Etat verfügen, um Inhalten bei Dritten in Auftrag zu geben.
Nutzer sollen sich registrieren, um Inhalte zu personalisieren und ihnen mit Hilfe der Daten neue Themen und wichtige Fragen vorzustellen. Nutzerinhalte sind auf der Plattform nicht vorgesehen, aber Nutzer sollen Inhalte bekommen, um damit zu spielen, ihre eigenen Playlists zu erstellen oder sie in ganz andere Umgebungen zu tragen.
Die Plattform selbst solle zu einer Anlaufadresse für Nutzer werden, doch erwartet die BBC, dass ihre Inhalte über andere Wege gefunden werden, über Suchmaschinen, vor Ort in einem Museum, über die Leseliste in einem Gymnasialkurs oder über TV- und Radiosendungen.
Der Erfolg des Ideas Service werde sich nicht allein an Reichweite und Akzeptanz bemessen, sondern auch daran, dass die besten geistigen und kulturellen Institutionen und Personen des Landes ein viel größeres Publikum in UK und weltweit finden und die Neugier und den Ehrgeiz einer neue Generation inspirieren (ebd.: 70 f.). Der Ideas Service wird mit zwei Angeboten starten: „UK Arts“ für Kunst und Kultur und „A New Age of Wonder“ für Wissenschaft und Bildung.
Die UK Arts-Plattform soll „international anerkannte Marken“ in einem globalen One-stop-shop zusammenbringen, „like the BBC itself, the Tate, the Edinburgh Festivals, Whitworth, the Royal Court, the British Museum and the Royal Shakespeare Company to those who champion excellence and innovation inside the UK like Slung Low, Tramway, Liverpool Biennial and Manchester’s Contact Theatre“ (BBC 2015: 72).
Um neue Online-Formate zu entwickeln arbeitet die BBC bereits mit Doteveryone zusammen. Das Projekt ist 2015 von Martha Lane Fox gegründet worden, Internet-Entrepreneurin, Mitgründerin von Lastminute.com, Aufsichtsratsmitglied von Channel 4 (2007-2011) und von Twitter (seit April 2016), Regierungsberaterin in Sachen Digitalisierung und seit März 2014 Kanzlerin der Open University. Ihr Anliegen, das Verständnis für das Internet auf allen Ebenen der Gesellschaft zu verbessern, mehr Frauen in die Technologie zu bekommen und die ethischen Fragen des Internet anzugehen, legte sie im März 2015 in ihrer Richard Dimbleby-Vorlesung mit dem Titel „Dot Everyone – Power, the Internet and You“ dar.
Neben berühmten Marken soll UK Arts auch neue Talente fördern. Die Inhalte sollen zusätzlich auf den Sites der Partner erscheinen und „so weit wie möglich durch soziale Medien und andere Distributionsplattformen reisen“. Nutzer erhalten die Möglichkeit, Inhalte zu bearbeiten und remixen. Das Portal BBC Arts bildet vermutlich eine Vorstufe für UK Arts, doch noch schließen zahlreiche iPlayer-Angebote die Welt aus.
 A New Age of Wonder hat zum Ziel, Forschung zu vermitteln und künftige Wissenschaftler und Ingenieurinnen zu inspirieren. Das Partnernetzwerk besteht hier aus Universitäten, Museen, Schulen, Wissenschaftsgesellschaften und Forschungseinrichtungen, darunter The Royal Society, The Science Museum Group, The Natural History Museum, The Royal Institution, The Wellcome Trust, The British Science Association, The British Library, The British Academy, Universities UK, The Royal Academy of Engineering, The Academy of Medical Sciences, The Royal Botanic Gardens und viele weitere.
A New Age of Wonder hat zum Ziel, Forschung zu vermitteln und künftige Wissenschaftler und Ingenieurinnen zu inspirieren. Das Partnernetzwerk besteht hier aus Universitäten, Museen, Schulen, Wissenschaftsgesellschaften und Forschungseinrichtungen, darunter The Royal Society, The Science Museum Group, The Natural History Museum, The Royal Institution, The Wellcome Trust, The British Science Association, The British Library, The British Academy, Universities UK, The Royal Academy of Engineering, The Academy of Medical Sciences, The Royal Botanic Gardens und viele weitere.
A New Age of Wonder soll sich an alle richten, von Grundschülern bis zu Professoren und Citizen Scientists. Das Gesicht des Angebots ist der Physiker und bekannteste Wissenschschaftspräsentator der BBC Brian Cox, der diesen Ideas Service bei der Präsentation der BBC-Pläne vorstellte.
Die BBC verspricht nichts weniger als die größte wissenschaftliche Engagement-Kampagne in der britischen Geschichte. Gestartet ist sie im September 2016 mit einer Kampagne zu 100 großen Fragen der Wissenschaft, die die wohltätige Bildungsinitiative Eden Project durchführt. Ihre Pläne für den Ideas Service fasst die BBC so zusammen: „Where Google’s mission is to organise the world’s information, ours would be to help everyone understand it.“ (BBC 2015: 74)
Die Neuerfindung der Bildungsmission der BBC umfasst neben dem Ideas Service die Kinderinhalte, vor allem von CBBC und Cbeebies. Diese will die BBC in einer eigenen kindergerechte Version des iPlayer zusammenfassen, die außerdem eine geschützte Umgebung bietet, in der Kinder miteinander interagieren und ihre eigenen Schöpfungen teilen können (BBC 2015: 74 f.). Im Konzept hieß sie noch „iPlay“, inzwischen ist sie als iPlayer Kids gestartet. Ihre formelleren, curriculumsbezogenen Bildungsangebote hatte die BBC bereits 2006 unter dem Dach von Bitesize zusammengefasst.
Unter „Educate“ führt das Konzept außerdem BBC News und BBC Sport mit dem Sport-bezogenen Wissenschaftsangebot iWonder an, das inzwischen jedoch eingestellt wurde.
Im Dezember 2016 wurde die Royal Charter for the continuance of the BBC und das begleitende Agreement Between Her Majesty’s Secretary of State for Culture, Media and Sport and the British Broadcasting Corporation verabschiedet, die beide im Januar 2017 in Kraft traten. Wichtigste Aufgabe der Charter ist die Verteilung der Aufgaben des aufzulösenden BBC Trust auf das neue Direktorium und Ofcom.
Das Agreement spezifiziert die neuen Aufgaben der Ofcom im Detail. Der Public Value Test wird in „Public Interest Test“ umbenannt, bleibt aber in der Sache unverändert und prüft weiterhin, ob der Public Value einer vorgeschlagenen Veränderung mögliche nachteilige Auswirkungen auf den Wettbewerb rechtfertigt (DCMS 2016a: 7; 12).
Die größten Veränderungen reagieren auf die Vorwürfe der Medienindustrie, die beitragsfinanzierten Angebote der BBC würden den Markt schädigen. Daher werden Teile der Beitragsfinanzierung ‚contestable‘ gemacht, d. h. über Ausschreibungsverfahren vergeben, an denen sich externe Anbieter genauso wie die BBC beteiligen kann. In der letzten Charter-Erneuerung hatte sich die BBC vehement gegen dieses Verfahren ausgesprochen (BBC 2004: 117). Nun wird sie dazu verpflichtet, dass in jedem Jahr nicht weniger als 25% der Sendezeit von BBC One und Two aus unabhängigen Produktionen besteht (DCMS 2016a: 59 f.). In den Bereichen Schauspiel, Comedy, Unterhaltung und Dokumentation sind bis Ende 2018 40% im Wettbewerb zwischen BBC-internen und externen Produzenten zu vergeben. Bis Ende 2019 sollen alle TV-Sendungen in den Bereichen Kinder, Sport und aktuelle Berichterstattung mit Ausnahme von Nachrichten ‘contestable’ werden, bis 2027 schließlich sämtliche TV-Programme und Online-Angebote. 60% der Radioprogramme werden bis Ende 2022 ausgeschrieben (ebd.: 59).
Den Vorschlägen, die BBC insgesamt oder in Teilen auf eine Abo-Finanzierung umzustellen, erteilt das Agreement eine klare Absage: Für den Empfang von öffentlich-rechtlichen Diensten in UK dürfen über die licence fee hinaus keine Gebühren erhoben werden (ebd.: 57)
Der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag in Deutschland
Das Recht zur Einrichtung und zum Betrieb von Sendeanlagen wurde 1919 der Deutschen Reichspost übertragen. Die Inhalte des Kulturinstruments Radio unterstanden in der föderalen Weimarer Republik der Hoheit der Länder. In diesen wurden ab 1922 regionale privatwirtschaftliche Rundfunkgesellschaften gegründet. Offiziell startete der Rundfunk in Deutschland 1923 mit Radiosendungen aus dem Vox-Haus in Berlin. Im selben Jahr wurde auch die Rundfunkgebühr eingeführt. Die Kulturhoheit der Länder schloss anfangs eine journalistisch-politische Berichterstattung aus. Im Vordergrund stand ein bürgerliches Bildungsprogramm mit Konzerten, Vorträgen und Hörspielen (Hagen 2005: 78 ff.). 1933 wurden die Rundfunkgesellschaften aufgelöst und dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda unter Joseph Goebbels unterstellt, der das Radio zum wichtigsten Instrument der Gleichschaltung und Kriegsvorbereitung machte.
Das Fernsehen in seiner von Paul Nipkow bereits 1884 entwickelten Form hatte auf der Funkausstellung in Berlin 1928 seine Premiere. 1930 ersetzte Manfred von Ardenne die Nipkowscheibe als Bildgeber durch eine Braun’sche Röhre und steigerte damit die Zahl der Bildzeilen. Der erste regelmäßige Fernsehprogrammbetrieb der Welt wurde am 22. März 1935 in Berlin aufgenommen. Auch das Fernsehen war Goebbels’ Propagandaministerium unterstellt, der es vor allem während der Olympischen Spiele 1936 in Berlin national wie international wirkungsvoll einsetzte.
1945 übernahmen die Besatzungsmächte den Rundfunkbetrieb in Deutschland. In Westdeutschland wurden zwischen 1948 und 1949 durch Landesrundfunkgesetze neue Landesrundfunkanstalten gegründet. 1950 schlossen sich sie sich zur Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammen. Mit der Gründung der DDR 1949 ging der Rundfunk in der Sowjetischen Besatzungszone komplett an die Staatspartei SED über. Der deutsche Dienst der BBC übernahm ab November 1945 die Aufgabe der Umerziehung und Propaganda gegen die Sowjets. In Westdeutschland diente die BBC als Vorbild für die Neuorganisation des Rundfunks.
Bildung in einem weiten Sinne gehörte von Anfang an zum Auftrag des Rundfunks in Deutschland. Das Schulfernsehen wurde jedoch erst eingeführt, als Mitte der 1960er der Pädagoge Georg Picht dem Land eine „Bildungskatastrophe“ attestiert hatte. Im Zuge der damit ausgelösten Debatte startete als erster der Bayerische Rundfunk 1964 das Schulfernsehen. Die anderen Länderanstalten folgten, bis es 1972 flächendeckend zur Verfügung stand.
Anders als in Großbritannien, ist in Deutschland und Österreich ein von der Verfassung ausgehender, hoheitlich erteilter Auftrag Grundlage des öffentlich finanzierten Mediensystems.
Grundgesetz & Bundesverfassungsgericht
Ausgangspunkt des Rundfunkrechts in Deutschland ist Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Darin heißt es: „Die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk [wird] gewährleistet.“ Im selben Satz werden auch die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Film gewährleistet. Im dritten Absatz wird die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre bestimmt.
Im föderalen System kommt den Ländern die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse auf den Gebieten der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks zu (Art. 23 Abs 6 GG). Bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre können Bund und Länder zusammenwirken (Art. 91b GG).
Das Rundfunkrecht wird maßgeblich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) weiter entwickelt. Allerdings bleibt der Bildungsauftrag in mehr als einem Dutzend Rundfunkurteilen seit 1961 bemerkenswert unterbelichtet.
In der ersten Rundfunkentscheidung vom Februar 1961 hatte das BVerfG über die Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern zu befinden. Es schloss an die in der Weimarer Republik erfolgten Aufteilung an, der zufolge der Bund die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das “Post- und Fernmeldewesen” hat, also die technische Hoheit über Rundfunksender, nicht aber über Studiotechnik und keineswegs über die Veranstaltung der Rundfunksendungen. Zum Rundfunk als „kulturellem Phänomen“ schrieb das Gericht: „Soweit kulturelle Angelegenheiten überhaupt staatlich verwaltet und geregelt werden können, fallen sie aber nach der Grundentscheidung des Grundgesetzes in den Bereich der Länder.“ Insofern erkannte das BVerfG sowohl ein ausschließliches Recht des Norddeutschen Rundfunks, sendetechnische Anlagen zu errichten und zu betreiben, als verfassungswidrig, wie auch den Versuch des Bundes, durch Gründung der Deutschland-Fernsehen-GmbH einen zweiten bundesweiten Fernsehkanal zu etablieren.
In diesem Urteil führte das BVerfG die Formel vom Rundfunk als „Medium und Faktor“ der Meinungsbildung ein:
„Der Rundfunk ist mehr als nur ‘Medium’ der öffentlichen Meinungsbildung; er ist ein eminenter ‘Faktor’ der öffentlichen Meinungsbildung. Diese Mitwirkung an der öffentlichen Meinungsbildung beschränkt sich keineswegs auf die Nachrichtensendungen, politischen Kommentare, Sendereihen über politische Probleme der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft; Meinungsbildung geschieht ebenso in Hörspielen, musikalischen Darbietungen, Übertragungen kabarettistischer Programme bis hinein in die szenische Gestaltung einer Darbietung. Jedes Rundfunkprogramm wird durch die Auswahl und Gestaltung der Sendungen eine gewisse Tendenz haben, insbesondere soweit es um die Entscheidung darüber geht, was nicht gesendet werden soll, was die Hörer nicht zu interessieren braucht, was ohne Schaden für die öffentliche Meinungsbildung vernachlässigt werden kann, und wie das Gesendete geformt und gesagt werden soll. Bei solcher Betrachtung wird deutlich, daß für den Rundfunk als einem neben der Presse stehenden, mindestens gleich bedeutsamen, unentbehrlichen modernen Massenkommunikationsmittel und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung die institutionelle Freiheit nicht weniger wichtig ist als für die Presse.“ (BVerfGE 12, 205, 1961)
„Bildung“ taucht in diesem ersten Rundfunkurteil an zwei Stellen auf. Zum einen im Rückgriff auf die Weimarer Republik. Hier waren den Programmgesellschaften Beiräte beigestellt, „zur Mitwirkung an der Gestaltung des Programms hinsichtlich der Darbietungen auf dem Gebiete von Kunst, Wissenschaft und Volksbildung“. Der „Überwachungsausschuss für den Nachrichten- und Vortragsdienst“, hatte ein Einspruchsrecht gegenüber allen Teilen des Programms, soweit es sich nicht lediglich um Fragen der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung handelte (ebd.).
Zum anderen setzte sich das Gericht mit der Begründung der Adenauer-Regierung einer natürlichen Bundeskompetenz zur Veranstaltung von Rundfunksendungen aus der „Notwendigkeit nationaler Repräsentation nach innen, d. h. der Selbstdarstellung der Nation vor der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland“, sowie aus dem Gebot, die “kontinuitätsbewahrende Tradition” zu pflegen, auseinander. Das BVerfG erkennt es als notwendig, beides von Staats wegen zu fördern. „Es ist aber unverkennbar, daß mit ihnen Aufgaben bezeichnet sind, die sich einer näheren Bestimmung entziehen. Es gibt viele Institutionen und Veranstaltungen kultureller Art, die der nationalen Repräsentation nach innen zu dienen bestimmt sind. Letztlich kann das gesamte Erziehungs- und Bildungswesen als Pflege ‘kontinuitätsbewahrender Tradition’ verstanden werden.“ (Ebd.)
In der zweiten Rundfunkentscheidung aus dem Mai 1971 ging es um die Frage, ob Rundfunkanstalten „gewerblich oder beruflich“ im Sinne des Steuerrechts tätig sind. Dies verneinte das BVerfG, denn sie erfüllten eine öffentliche Aufgabe und hätten eine Funktion für das Staatsganze. Rundfunk dürfe nicht dem „freien Spiel der Kräfte“ überlassen werden, sondern ist „Sache der Allgemeinheit“. „Er muß in voller Unabhängigkeit überparteilich betrieben und von jeder Beeinflussung freigehalten werden. Die Darbietungen sollen ‘Nachrichten und Kommentare, Unterhaltung, Bildung und Belehrung, Gottesdienst und Erbauung vermitteln und dem Frieden, der Freiheit und der Völkerverständigung dienen’.“ Weiter führt das Urteil aus, umfasse die öffentliche Aufgabe, „Information, Kritik und Kommentar über aktuelle politische Vorgänge, über gesellschaftliche Prozesse und über kulturelle Erscheinungen im weitesten Sinn, Darbietungen kultureller und bildender Art – Konzerte, Fernsehspiele, Theater und wissenschaftliche Vorträge –, Unterrichts- und Fortbildungsprogramme (z. B. das Schulfernsehen) und Darbietungen der Unterhaltung (Film, Kabarett, Revue, Sportschau und Showgeschäft).“ (Ebd.)
Nach der Einführung des dualen Rundfunksystems in den beiden vorangegangenen Entscheidungen hatte das BVerfG im fünften Rundfunkurteil von März 1987 über eine Regelung des Landesmediengesetzes von Baden-Württemberg zu entscheiden. Darin hatte die Landesregierung vorgesehen, private Anbieter bei bestimmten Programmformen von einer Konkurrenz der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zumindest initial freizuhalten, darunter „in erster Linie Regional- und Lokalprogramme sowie Programme, die auf bestimmte Arten von Information, Bildung oder Unterhaltung spezialisiert sind (Spartenprogramme) und nur für solche Bürger verbreitet werden, die ihr besonderes Interesse durch Abschluß eines Abonnementvertrages bekundet haben,“ aber auch Neue Medien wie Bildschirmtext u. a. Abrufdienste. Dagegen hatten der Süddeutschen Rundfunk und der Südwestfunk geklagt und recht bekommen. Spartenprogramme im Kultur- und Bildungsbereich seien von privaten Anbietern nicht zu erwarten. Den Öffentlich-Rechtlichen solche Programme zu untersagen, „würde der Gewährleistung der Rundfunkfreiheit zuwiderlaufen.“ Ferner entschied das Gericht in Bezug auf Neue Medien, dass der Begriff „Rundfunk“ des Art. 5 GG sich mit Veränderungen im Normbereich wandele. Die Einbeziehung „rundfunkähnlicher Kommunikationsdienste“ in den Schutzbereich der Gewährleistung des Art. 5 GG erscheint dem BVerfG geboten, „zumal die hier in Betracht zu ziehenden Dienste sich von herkömmlichem Rundfunk nicht wesentlich unterscheiden. … Das Bestreben, zunächst privaten Anbietern eine Chance zu geben, kann auch hier zu einer Beschränkung des Grundrechts nicht ausreichen.“
In der folgenden sechsten Rundfunkentscheidung von Februar 1991 bekräftigte das BverfG die Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die nichts anderes seien „als die Sicherung der Voraussetzungen, die die Grundversorgung der Bevölkerung möglich machen.“ Sie erstrecken sich auch „auf neue Dienste mittels neuer Techniken, die künftig Funktionen des herkömmlichen Rundfunks übernehmen können.“ Außerdem setzte sich das BVerfG hier zum ersten und bislang einzigen Mal mit Schulfunksendungen auseinander. 236 Bundestagsabgeordnete aus den Fraktionen der CDU/CSU und der FDP hatten beantragt, Teile des WDR-Gesetzes für nichtig zu erklären, darunter die Paragraphen, die es dem WDR ermöglichen, Bildungssendungen mit Schulcharakter zu veranstalten, die zu schulischen Abschlüssen führen. Diese sind organisatorisch vom übrigen Rundfunkbetrieb zu trennen und müssen den staatlichen Unterrichtsrichtlinien entsprechen. Sie werden zudem von einem eigenen Schulrundfunkausschuss überwacht, dessen Zusammensetzung sich von der des Rundfunkrats unterscheidet.
Die Antragsteller sahen darin einen verfassungswidrigen Versuch der Abwägung zwischen dem staatlichen Auftrag zur Gewährleistung einer staatsfreien Veranstaltung von Rundfunk des Art. 5 GG und dem Art. 7 GG, dem zufolge das gesamte Schulwesen unter der Aufsicht des Staates steht. Das Gericht entschied:
„Bildungssendungen mit Schulcharakter im Sinn von § 3 Abs. 4 WDR-G sind einerseits Rundfunksendungen und nehmen insofern an der Rundfunkfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG teil. Sie unterliegen daher grundsätzlich nicht der staatlichen Kontrolle. Andererseits teilen sie wesentliche Merkmale mit der Schule, die von Art. 7 Abs. 1 GG unter die Aufsicht des Staates gestellt wird. Zwar fehlt es bei den Bildungssendungen an der gemeinschaftlichen Unterweisung in räumlicher Hinsicht, die herkömmlich zum Begriff der Schule gehört. Doch besteht die Möglichkeit, aufgrund der Bildungssendungen und der sie begleitenden Leistungs- und Erfolgskontrollen schulische Abschlüsse und staatlich anerkannte Zeugnisse zu erlangen. Der Staat hat daher ein legitimes Interesse an der Kontrolle der Bildungsqualität der Sendungen sowie der Gleichwertigkeit der Prüfungsanforderungen. Staatsfreiheit des Rundfunks und Schulaufsicht des Staates müssen deswegen insoweit zu einem angemessenen Ausgleich gebracht werden.
Es kann offen bleiben, ob zur Erreichung dieses Ziels nur die durchgängige Bindung der Bildungssendungen an die staatlichen Unterrichtsrichtlinien gemäß § 3 Abs. 4 Satz 2 WDR-G sowie ein eigenes Anstaltsorgan, das nach § 28 Abs. 1 Satz 2 WDR-G alle Bildungssendungen genehmigen muß und dabei nach § 29 Abs. 2 Satz 2 WDR-G der Zustimmung der Vertreter der Landesregierung bedarf, in Frage kam. Bei verfassungskonformer Auslegung lassen sich die Vorschriften jedenfalls mit Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG vereinbaren. Das von Art. 7 Abs. 1 GG legitimierte staatliche Interesse an einer Mitsprache bei Bildungssendungen im Sinn von § 3 Abs. 4 WDR-G gründet sich auf die Tatsache, daß die Teilnahme am Bildungsprogramm des WDR zu anerkannten schulischen Abschlüssen führt. Die Bindung an die Unterrichtslinien, der Genehmigungsvorbehalt für die Sendungen sowie das insoweit bestehende Vetorecht der Regierungsvertreter müssen daher ihre verfassungsrechtliche Grenze dort finden, wo es nicht mehr um die Sicherung der Gleichwertigkeit der Bildungsveranstaltung und der durch sie vermittelten Prüfungen und Abschlüsse mit denen des staatlichen Schulwesens geht.“ (Ebd.)
Rundfunkstaatsvertrag
Eine Konkretisierung erhält der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen und damit auch seine Bildungskomponente im Staatsvertrag der Länder für Rundfunk und Telemedien (hier i. d. aktuellen Fassung des 19. RÄndStV, in Kraft seit Oktober 2016). Unter „Begriffsbestimmungen“ (§ 2) heißt es dort, dass unter Bildung insbesondere zu verstehen sei: „Wissenschaft und Technik, Alltag und Ratgeber, Theologie und Ethik, Tiere und Natur, Gesellschaft, Kinder und Jugend, Erziehung, Geschichte und andere Länder“. Wie die Begriffe „Information“ und „Kultur“ wird auch „Bildung“ sehr breit gefasst.
Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wird in § 11 definiert. Er kann in jedem einzelnen Punkt auf Bildungsziele bezogen werden:
- „durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung … wirken“;
- „dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft … erfüllen“;
- „in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen .. geben“;
- „hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern.“
Und dann heißt es abschließend: „Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen.“ Diese Kategorien sind jedoch nicht etwa als Programmgruppen zu verstehen. Darauf wies u. a. Dieter Stolte in einem Beitrag zum „Programmauftrag des Rundfunks“ hin (in: Stimmen der Zeit, Februar 1980). Stolte, Mitarbeiter des ZDF seit seiner Gründung 1962 und sein Intendant von 1982 bis 2002, bezeichnete es als unzutreffend, dass der Unterhaltungswert einer Information ihre Seriosität schmälere oder Bildung trocken, sachlich und vom Zeitgeist unabhängig sein müsse. „Zutreffender spräche man von drei Funktionen einer Sendung: Der Informationsfunktion, die den Wissenstand erweitert, der Unterhaltungsfunktion, die die Art und Weise meint, wie Sinne, Gefühle und Gemüt durch eine Sendung angesprochen werden, und der Bildungsfunktion, die sich in den vom Adressaten gezogenen Folgerungen für seine Einstellungen und sein Verhalten zeigt.“ (ebd.)
Ein Schwerpunkt Bildung wird unter den Fernsehprogrammen (§ 11b) dem Spartenprogramm ARD-alpha des Bayerischen Rundfunks zugewiesen, unter den Hörfunkprogrammen (§ 11c) dem Deutschlandradio.
Der Auftrag für Internet-Angebote („Telemedien“) findet sich in § 11d RStV. Hier kommen weitere bildungsrelevante Aufgaben hinzu:
- „Durch die Telemedienangebote soll allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht,
- Orientierungshilfe geboten sowie
- die technische und inhaltliche Medienkompetenz aller Generationen und von Minderheiten gefördert werden.“
Außer für Sendungen und sendungsbezogene Inhalte auf Abruf bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung ist ein Online-Angebot jeweils in einem Telemedienkonzept zu konkretisieren, das einer ex ante Überprüfung in drei Stufen unterzogen (§ 11f RStV) und über deren Auftragserfüllung alle zwei Jahre Bericht erstattet wird (§ 11e RStV).
Schließlich sind in den Aufsichtsgremien der Öffentlich-Rechtlichen Vertreter aus dem Erziehungs- und Bildungswesen, den Volkshochschulen und den Landesorganisationen der Weiterbildung vorzusehen. Vertreter des Bundesjugendrings sitzen in einigen den Rundfunkgremien. In einem Positionspapier fordern sie 2013: “Jugendliche an Medienangeboten beteiligen”.
Auch unter den Vorschriften für den privaten Rundfunk heißt es, dass die bundesweit verbreiteten Rundfunkvollprogramme zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum mit einem angemessenen Anteil an Information, Kultur und Bildung beitragen sollen (§ 41 Abs 2). Zur weiteren Sicherung der Meinungsvielfalt sind in den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten privaten Fernsehvollprogrammen Fensterprogramme aufzunehmen, die von unabhängigen Dritten veranstaltet werden (§ 25 Abs 4). Ein solches Fensterprogramm muss einen zusätzlichen Beitrag zur Vielfalt, insbesondere in den Bereichen Kultur, Bildung und Information leisten (§ 31 Abs 1).
Leitlinien ARD, ZDF
Der in Verfassung und Rundfunkstaatsvertrag erteilte Auftrag wird von den Anstalten in ihrer Programmautonomie eingefüllt und in Leitlinien und Telemedienkonzepten spezifiziert und damit einer ex ante und ex post Überprüfung zugänglich gemacht. Im aktuellen ARD-Bericht 2015/16 und ARD-Leitlinien 2017/18 für Das Erste wird der breit aufgefasste Bildungsbegriff deutlich.
Unter der Überschrift „Bildung, Wissen und Beratung“ (ebd.: 33 ff.) hebt der Bericht zunächst die einmal im Jahr stattfindende ARD-Themenwoche hervor, die sich 2016 mit der Zukunft der Arbeit beschäftigte. Unter den Programmen, die Wissenschaft auf unterhaltsame Weise an breite Zuschauerschichten vermitteln, nennt er „W wie Wissen“, „Quarks im Ersten“ und „Kopfball“.
Der einzige dezidierte Bildungskanal ARD-alpha bietet Schulfernsehen sowie Grips mit Lektionen für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathe. Telekolleg ist ein formelles Angebot des Zweiten Bildungsweges, das es erlaubt, berufsbegleitend die Fachhochschulreife erwerben. Alpha-Campus richtete sich auf die Bereiche Hochschule, Wissenschaft und Forschung. Ich mach’s berät bei der Berufswahl, indem es eine Fülle von Berufen vorstellt. Schließlich bietet ARD-alpha Sendungen zum Sprachenlernen. In den kommenden zwei Jahren soll ARD-alpha, das im TV und im Internet zu sehen ist, umfassend modernisiert und zu einer Online-Lernplattform ausgebaut werden (ebd.: 36).
Angebote für lebenslanges Lernen, selbstständige Weiterbildung und die Fortentwicklung der eigenen Fähigkeiten und Begabungen „begreift die ARD als eine programmliche Querschnittsaufgabe, die sich nicht nur auf einzelne Wissensendungen oder die Themenwoche beschränkt.“ (ebd.: 37 f.)
Mit seinen Kinderangeboten will die ARD erklärtermaßen „eine frühe Bindung an die öffentlich-rechtlichen Qualitätsprogramme und die Medienkompetenz … fördern“ (ebd.: 44). Hier hebt der Bericht „Die Sendung mit der Maus“ hervor, sowie den Kinderkanal KiKA, den ARD und ZDF gemeinsam betreiben. Das Angebot für 3- bis 13-Jährige erzielte 2015 einen Marktanteil in der Zielgruppe von 19%. Die darin enthaltene Vorschulsendestrecke KiKANiNCHEN für Drei- bis Fünfjährige erreichte in dieser Gruppe sogar einen Anteil von 37,3%. Die Websites der beiden Angebote wurden 2016 grundlegend überarbeitet. KiKA hat seither auch einen Youtube-Kanal (ebd.: 44 ff.). Im Dezember 2016 genehmigte der MDR-Rundfunkrat ein aktualisiertes Telemedienkonzept für KiKA. Darin werden die Aktivitäten auf Drittplattformen ausgeweitet und zugleich sichergestellt, dass Kinder auch hier einen vertrauenswürdigen Schutzraum vorfinden. Personalisierung wird ermöglicht und zugleich gewährleistet, dass relevante, bildende und zur Meinungsbildung beitragende Inhalte unabhängig von persönlichen Vorlieben allen Nutzern zur Verfügung stehen, um den Integrationsauftrag zu erfüllen. Die Verweildauer wird auf grundsätzlich bis zu zwei Jahre festgelegt. Die Barrierefreiheit des Angebots soll verbessert werden.
Der Bericht verweist auf ein eigenes Dokument zu den genrespezifischen Qualitätskriterien, in denen sich weitere Hinweise finden, wie der Bildungsauftrag operationalisiert wird.
Zu den digitalen Perspektiven der ARD gehört ein einheitlicher ARD-Player, die Bündelung aller Kinder-Inhalte der ARD, die Ausschöpfung der Verweildauern und Möglichkeiten zu Personalisierung (ebd. 56 ff.). Als eine ihrer vordringlichsten strategischen Aufgaben bezeichnet es die ARD, die Ansprache jüngerer Zielgruppen in allen Programmbereiche weiter zu verbessern (ebd.: 53).
Bildungsangebote Online
Seit 2009 schreibt der Rundfunkstaatsvertrag die Durchführung eines Drei-Stufen-Tests für Telemedien durch die Rundfunk-, Fernseh-, Hörfunkräte vor. Mehr als 53 Drei-Stufen-Tests sind bis heute in Deutschland durchgeführt worden (s.a. Bohdal/Belfin 2014: 91 ff.). Im Folgenden werden die wichtigsten bildungsrelevanten Angebote aufgeführt und auf die jeweiligen Telemedienkonzepte zur Charakterisierung der Angebote in der Fassung nach Durchlaufen des Tests verwiesen.
- Die Kinder-Website KiKANiNCHEN.de für Drei- bis Fünfjährige gehörten zu den ersten 2008 getesteten neuen Online-Angeboten. Gleichzeitig wurde KI.Kaplus, die Mediathek des von ARD und ZDF gemeinsam betriebenen Kinderkanal KiKA getestet. Das seit 2000 betriebene KiKA.de für 3- bis 13-Jährige wurde als Bestand 2010 überprüft.
Telemedienkonzept kikaninchen.de (02.12.2008)
Telemedienkonzept KI.Kaplus, die Mediathek des KI.KA (02.12.2008)
Telemedienkonzept kika.de (01.06.2010)
Telemedienkonzept aller Kika-Telemedien (28.10.2016).
- Das ZDF startete seine Kinder-Mediathek ZDFtivi im Dezember 2014. Hier bündelt sie altersgerechte Angebote von ZDF und KiKA. Nutzer können sich in Kommentaren austauschen und Spiele spielen.
Telemedienkonzept ZDF Telemedien (18.05.2010) tivi wurde als Teil des gesamten Online-Angebots des ZDF getestet.
- planet-schule.de von SWR und WDR bietet unterrichtsbegleitende Videos nach Fächern sortiert und Multimedia-Anwendungen wie Reportagen und Lernspiele. Zudem gibt es Schwerpunktthemen wie Demokratie, Flüchtlinge und Migranten, Klimawandel oder anknüpfend an das Wissenschaftjahr: Meere und Ozeane und einen eigenen Bereich zu Medienkompetenz.
Telemedienkonzept des SWR (Juni 2010) planet-schule.de wurde als Teil des gesamten Online-Angebots des ZDF getestet, darunter ferner das Jugendangebot DASDING.de und kindernetz.de.
Auf das seit 2012 geplante Jugendangebot von ARD und ZDF geht der folgende Abschnitt näher ein.
Funk.net
Nach dreißig Jahren Generationenabriss und der Erkenntnis, dass das Internet keine Modeerscheinung ist, die wieder weggeht, ist die deutsche Politik mutig gewesen. Auf ihrer Konferenz im Oktober 2014 beschlossen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder, ARD und ZDF damit zu beauftragen, ein Angebot für 14- bis 29-Jährige zu konzipieren – ausschließlich im Internet, ohne Sendungsbezug, ohne Drei-Stufen-Test, ohne Verweildauerbeschränkungen und mit einem Etat von 43 Millionen Euro.
Noch ein Jahr zuvor wollte die Politik, dass die Anstalten ein trimediales Jugendangebot entwickeln: ein Fernsehsender mit Zweitverwertungen aus den Jugendradios und ein bisschen Internet. Zur MPK im Oktober 2013 legten ARD und ZDF ihr Konzept dafür vor. Im März 2014 gab BBC-Intendant Tony Hall bekannt, dass aufgrund massiver Budgetkürzungen der trimediale Jugendkanal BBC Three, der dem deutschen Jugendangebot als Vorbild diente, ab Herbst 2015 nur noch online im BBC iPlayer weitergeführt werde. Die deutschen Landeschefs folgten und wollten nun auch ein online-only Angebot unter Federführung des SWR und finanziert durch die Einstellung der beiden digitalen Fernsehkanäle ZDFkultur und EinsPlus.
Im März 2015 gaben die Intendanten bekannt, dass Florian Hager, bis dato stellvertretender Programmdirektor von Arte, das Online-Jugendangebot leiten werde. Im Juni legten die Anstalten ihr Konzept vor. Auch wenn das Jugendangebot ausdrücklich ohne Drei-Stufen-Test direkt im Rundfunkstaatsvertrag beauftragt werden sollte, wurde gleichwohl der Marktauswirkungstest der zweiten Stufe bei Goldmedia beauftragt. Im Juni und Juli 2015 wurde eine offene Konsultation durchgeführt, auf die knapp 40 Stellungnahmen von Anstalten, Gremien und Verbänden eingingen. Nur dass am Ende nicht ein Rundfunkrat entschied, sondern die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Das taten sie mit der Ratifizierung des 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrags am 3. Dezember 2015 (s. § 11g Jugendangebot, RStV). Nach Zustimmung der Landesparlamente trat er zum 1. Oktober 2016 in Kraft.
Im Telemedienkonzept heißt es, das junge Angebot solle ein „Content-Netzwerk“ auf Drittplattformen wie Facebook und Youtube mit einer schlanken eigenen Landing-Page werden. Die Strategie geht von einem eingetretenen Generationenabriss aus: ‘Wenn die jungen Menschen nicht zu uns kommen, müssen wir dorthin gehen, wo sie sich aufhalten’.
Inhaltlich hat es mit Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung sowie Beiträgen zur Kultur den klassischen, öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrag zu erfüllen. Der besondere Beitrag ergibt sich daraus, dass das Jugendangebot die Lebenswirklichkeit und die Interessen junger Menschen in den Mittelpunkt stellt und den spezifischen Nutzungsgewohnheiten der jungen Menschen Rechnung trägt. „Das Jugendangebot richtet sich an Schüler, Studenten und junge Berufstätige aus allen Bildungsschichten und damit an junge Menschen, die in Bewegung sind und nach Orientierung suchen.“
Sowohl für den Bereich Information wie für Wissen und Wissenschaft besagt das Konzept, dass komplexe Sachverhalte mit einfachen Mitteln „zielgruppengerecht aufbereitet und Zusammenhänge erläutert [werden], um einen direkten und teilbaren Nutzwert zu erzeugen. … Klassische Bildungsthemen aus Schule und Studium können hier leicht zugänglich über Animationen dargestellt werden.“ Einen eigenen Bereich Bildung gibt es im Konzept nicht.
Schließlich verbindet sich mit dem Jungen Angebot die ausdrückliche Hoffnung, darüber ARD und ZDF insgesamt zu verjüngen (zu Hintergrund und Kritik des Konzepts s. Grassmuck 17.06.2015).
Am 1. Oktober 2016 startete das nun „Funk“ getaufte Jugendangebot auf den sozialen Netzen YouTube, Facebook, Snapchat und Instagram sowie auf der eigenen Plattform Funk.net mit rund 40 einzelnen Formaten. Getragen wird es von einem Team von etwa 40 Menschen in Mainz sowie Redaktionen in den neun ARD-Landesrundfunkanstalten und beim ZDF.
Nach dem ersten halben Jahr „Funk“ teilte die Vize-Programmgeschäftsführerin Sophie Burkhardt (ZDF) mit, dass die Angebote zusammen fast 150 Millionen Abrufe erhalten hatten. 103 Millionen Mal wurden sie auf Youtube geklickt, 44 Millionen Mal auf Facebook. Bei YouTube haben sie rund zwei Millionen Abonnenten, bei Facebook etwa 350.000 Fans (Süddeutsche 01.04.2017).
Auch die Hoffnung, dass von Funk eine Erneuerungswirkung auf ARD und ZDF insgesamt ausgeht, scheint sich zu bewahrheiten. Die Idee eines Content-Netzwerks das dorthin geht, wo die Nutzer sind, in die sozialen Netzwerke und auf andere Drittplattformen, ist für Funk formuliert worden. Nun taucht sie in einem ARD-Papier zu Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Zeiten der Digitalisierung der Medien vom November 2016 auf. Damit reagiert die ARD auf die im März 2016 eingesetzten „AG Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“ der Rundfunkkommission der Länder (vgl. Medienpolitik.net 23.11.2016). Darin bezeichnet die ARD sich insgesamt als Content-Netzwerk. Sie plant, die Landesrundfunkanstalten zu crossmedialen Medienhäusern sowie die gesamte ARD zu einem integrierten föderalen Medienverbund zu transfomieren. Die Aktivitäten auf Drittplattformen sollen ausgeweitet, aber auch nutzerfreundliche Alternativen angeboten werden, die die Kontrolle der Daten für Nutzerinnen und Nutzer sicherstellen.
Exkurs: Gespräch mit Florian Hager
Kurz vor der Halbjahresgrenze hatte ich Gelegenheit, mit Programmgeschäftsführer Florian Hager zu sprechen:
| VG: Im Rückblick auf das erste halbe Jahr Funk war die online-only-Entscheidung richtig?
Florian Hager: Unter Erfolgsgesichtspunkten hätte uns ein linearer Kanal oder ein trimediales Angebot eine größere technische Reichweite gegeben und damit natürlich auch einen größeren Erfolg. Wir gehen den schwierigeren Weg. Online-only begeben wir uns auf ein sehr wettbewerbsträchtiges Feld. Wir sind die Neuen, müssen um jeden Nutzer kämpfen. Leute, die im Internet sehr erfolgreich sind, sagen: Zwei bis fünf Jahre brauchst du, um etwas Nachhaltiges aufzubauen. Unter dem Gesichtspunkt Innovationsmotor für ARD und ZDF sind wir gezwungen, komplett umzudenken. Nicht: ‘Wir haben die Inhalte und müssen sie nur auf social media verteilen.’ Wir haben einen online-only Auftrag, da ist nichts Lineares dahinter. Deshalb sind Inhalte entstanden, die dieser Logik entsprechen. Deshalb war es für’s System das einzig Richtige. Wir sind nicht daran interessiert, mit großem Aufwand möglichst schnell einzelne Videos an möglichst viele Menschen zu verteilen, sondern wir wollen eine nachhaltige Reichweite. Dafür brauchen wir länger. Sieht man auch bei allen erfolgreichen Youtubern. Le Floyd hat, glaube ich, sieben Jahre gebraucht, um Relevanz zu erzeugen. Das ist vielen nicht bewusst. Dafür sind wir total überrascht, wie erfolgreich wir schon sind. Aber mit dem Vorsichtigkeits-Disclaimer: Das ist noch gar nichts. Wir haben ein Pflänzchen gesät, bis das ein Baum wird, braucht es sicher noch zwei Jahre. Ich hoffe, die haben wir auch. Genau die Diskussion wird im Augenblick geführt. Ich kriege es aus dem Bauch des Unternehmens ARD und ZDF mit: Das rumpelt schon ganz gewaltig. Ich hoffe, dass wir noch die Chance bekommen, Funk über zwei bis drei Jahre aufzubauen und nicht vorher schon in eine Drucksituation geraten. Auch BBC Three sagt nach der Umstellung auf online-only: Erwartet nicht, dass wir sofort einen Riesenerfolg haben. Die haben sich nicht freiwillig dafür entschieden, sondern sind aus finanziellen Gründen dazu gezwungen worden. Die Situation lässt sich schwer mit der in Deutschland vergleichen. BBC One hat noch Reichweite unter 14- bis 29-Jährigen. Sie können Inhalte anderswo entwickeln und auf BBC One ausstrahlen. Dann haben sie den iPlayer mit einer weiten Verbreitung. Daher ist ihre Strategie, TV-artigen Content zu produzieren. Vielleicht mit neuen Entwicklungsmethoden, so haben sie eine Plattform, wo sie früh Inhalte einstellen, mit Nutzern diskutieren und abstimmen lassen. Aber am Ende kommen TV-Inhalte raus, für BBC One oder den iPlayer. Und ich glaube, die Strategie geht für die ganz gut auf. VG: Wie ist das Verhältnis zwischen den Drittplattformen und eurer eigenen Plattform Funk.net? Florian Hager: Wir brauchen Unabhängigkeit und deshalb unsere eigene Site. Unter Datenschutz-Gesichtspunkten ist die hundertprozentig. Hier betten wir die Videos nicht von Youtube ein, sondern hosten sie selbst und zeigen sie im eigenen Player. Wenn Facebook oder Youtube sagen: ‘Euer Video publizieren wir nicht’, sind wir trotzdem in der Lage, sie zu veröffentlichen. Deshalb arbeiten wir nicht nur mit einer Drittplattform zusammen. Das machen PBS in den USA, die einen Exklusivvertrag mit Youtube haben. Das ist absolut nicht unsere Strategie. Unsere Strategie ist, dahin zu gehen, wo die Nutzer sind, und sie nicht auf unsere Seite zu zwingen, was eh unmöglich ist. Aber es bleibt ein Dilemma, das kann man ganz offen und ehrlich sagen: Wir begeben uns da in eine Umgebung, wo wir auf das ganze Umfeld keinen Einfluss haben. Inhaltlich sind wir frei zu machen, was wir wollen. Wir unterliegen nicht einem Algorithmen-Druck. Wir gucken natürlich, wie unsere Inhalte performen, aber wir müssen nicht alles tun, damit es möglichst schnell ein Erfolg wird. Bei TV liefert die GfK Zahlen. Hier sind wir angewiesen auf die Zahlen, die uns die Plattformen geben. Was uns nicht so stört, aber auf einer höheren Ebene ist das auch ein Dilemma. Deshalb versuchen wir, damit transparent umzugehen und, wenn wir über Zahlen reden, immer den Disclaimer zu machen, dass das natürlich die Zahlen der Plattformen sind, dass die Video-Messung schwierig ist, dass Youtube anders misst als Facebook und dass die Zahlen daher nicht zu vergleichen sind. Es ist ein Dilemma, aber auch nicht so ungewohnt. Dass wir dahin gehen, wo die Nutzer sind, halt ich mit Merkel für ‘alternativlos’. VG: Diese Abhängigkeit von den Drittplattformen führt aktuell viele Beobachter dazu, eine eigene öffentlich-rechtliche Plattform zu fordern und dabei auf die BBC zu verweisen. So zog sich die eigene Plattform als roter Faden durch eine Veranstaltung der ARD-Generalsekretärin zum Auftrag der Zukunft vor zwei Wochen in der Humboldt-Universität. Neben der Abhängigkeit nannte Tabea Rößner (medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen) einen weiteren Grund: Nutzer rechneten Inhalte eher der Plattform, z. B. Youtube oder Facebook, zu als als dem tatsächlichen Absender, einem öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerk. Florian Hager: Die Frage ist die richtige. Wenn es eine so etablierte Plattform gäbe wie den iPlayer, dann wäre es klar, dass wir unsere Inhalte auf dieser Plattform ausspielen würden. Der Auftrag von Funk ist es, 14- bis 29-Jährige zu erreichen, die einen kleinen Teil der Bevölkerung darstellen. Dafür sind wir gut ausgestattet. Aber dass wir diese Open Space-Plattform aufbauen sollten, wäre eine viel zu große Bürde. Wir sind zu klein, als dass Funk als Blaupause dafür gelten könnte. Deshalb machen wir aus der Not eine Tugend und sagen ganz radikal: Uns ist unsere Plattform völlig egal. Wir haben den Auftrag, Inhalte zu machen, die 14- bis 29-Jährige erreichen, und das machen wir, indem wir dahin gehen, wo die Nutzer sind. Natürlich werden wir versuchen, wie jeder, der auf Drittplattformen unterwegs ist, auch ein paar Prozent ins eigene Angebot zu holen. Aber auch hier gilt: Selbst die größten Youtuber schaffen es nur, 3-4% ins eigene Angebot zu kriegen. Da kannst du dir überlegen, wie viele Leute wir draußen erreichen müssen, damit es sinnvoll ist für’s eigene Angebot. Wir sind da realistisch. Wenn es die Plattform irgendwann mal gibt, sind wir sofort dabei, völlig klar. Es muss eine sein, die ARD und ZDF gemeinsam veranstalten plus Hochschulen und andere, wie bei der BBC. Das fände ich auch mega-spannend. Dann hätten wir wieder die Hoheit über die Daten und die Umgebung. Das wäre eine andere Voraussetzung. Aber eine solche Plattform ist politisch noch längst nicht auf der Reihe. Bis die aufgebaut ist, gehen locker noch ein paar Jahre ins Land. Die hab ich nicht.“ VG: Beim Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen kann man ein enges Verständnis, etwa Schulfunk und Telekolleg, und ein weites Verständnis unterscheiden, nach dem Bildungsaspekte alle Angebote durchziehen sollen, also eine Querschnittsaufgabe sind. Wie versteht Funk seinen Bildungsauftrag? Florian Hager: Wir haben drei Über-Genres, in denen wir aktiv sein wollen: Information, Orientierung und Unterhaltung. Information ist das, was du zitiert hast: Angebote für die Meinungsbildung. Unterhaltung ist relativ viel Fiktionales. Da gucken wir immer, dass es Themen aufgreift, die gesellschaftlich oder in der Zielgruppe Relevanz haben. Bei „Wishlist“ z. B. geht es um eine App, die die Kontrolle des Lebens von jungen Menschen übernimmt. Die von Radio Bremen initiierte Webserie mit drei Youtubern hat gerade den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Award bekommen. Ein weiteres Format wird sich mit jungen Menschen auf dem Land beschäftigen. Dabei geht es um diese Querschnittsgeschichten. Wie beim „Tatort“ wollen wir für Debatten sorgen. Der Bereich Orientierung – vielleicht die Übersetzung von ‘Beratung’ – ist für uns am Ende der Wichtigste. Die Zielgruppe 14 bis 29 ist sehr disparat. Die Lebenswirklichkeit eines 14-Jährigen hat nichts mit der einer 29-Jährigen zu tun. Aber es gibt vereinende Punkte wie Musik und Sport. Wir haben für uns definiert, dass es eine Phase der Orientierung, des Sich-selber-Definierens ist. 14- bis 16-Jährige definieren sich noch ganz stark über andere, über Protagonisten, Musiker, Stars. 25- bis 29-Jährige definieren sich mehr über Information und Bildung. Aber das allumfassende Thema ist Orientierung. Wir versuchen, Orientierung über die anderen beiden zu stellen und in den verschiedenen Lebenssituationen dafür zu sorgen, dass man sich mit unseren Inhalten orientieren kann; nicht, dass wir den Leuten top-down Orientierung geben, aber dass wir einen Beitrag dazu leisten. Bei unserem Bildungsangebot trennen wir klar, wie du gesagt hast, zwischen weitem und engem, auf Schule bezogenen Sinne. Wir fangen an mit „Musstewissen“, das seit zwei Wochen läuft. Das richtet sich an die 8. Klasse, das heißt, da sind auch Haupt- und Realschule mit dabei, mit verschiedenen Fächern, relativ klassisch. Wir versuchen auch, in die Berufsbildung und Berufsberatung zu gehen. Das wird nach und nach relativ groß werden. Da gehen wir speziell rein, weil wir glauben, dass wir da eine Grundaufgabe zu erfüllen haben. Wir wissen natürlich, dass es schon reichhaltige Angebote, Tutorials usw. im Netz gibt. Trotzdem sind wir der Meinung, dass es aus didaktischen und formalen Gründen Verbesserungsmöglichkeiten gibt und dass das unsere Aufgabe ist. Das Wichtigste im Netz: Wir müssen Anschlusskommunikation erzeugen. Das ist der Auftrag von Journalismus. Bei uns ist er noch direkter mit dem Medium verbunden, weil ich ein Video gleich kommentieren kann. Der Erfolg ist damit gekoppelt, dass wir etwas anreißen und jemand reagiert, was reinschreibt oder den Inhalt teilt – dass über das Video eine Kommunikation entsteht. VG: Das Wissenschaftsformat „Schönschlau“ würde ich auch noch zumindest in der Nähe eines engeren Bildungsauftrags sehen. Aber auch eine politische Satire wie „Datteltäter“ will Aufklärung und Orientierung bieten. Ist Humor eines der Standbeine von Funk? Florian Hager: Absolut. Das Gros der satirischen Formate ist, wie du umschrieben hast, kein Schenkelklopferhumor. „OMG“ ist noch ein bisschen zugänglicher, auch da sind immer gesellschaftliche, aus der Zielgruppe destillierte Themen mit drin. Das ist schon unser Anspruch, dass wir da nicht nur Quatschvideos machen. VG: Der zentrale Auftrag öffentlich-rechtlicher Medien ist es, der individuellen und kollektiven Meinungsbildung zu dienen und damit der Demokratie. Folglich müsste poltische Bildung Kern des Bildungsauftrags sein. Florian Hager: Definitiv. Bei uns kommt der Bereich jetzt erst zur vollen Blüte, weil es jetzt auf die Bundestagswahl zugeht. Da sehen wir, dass wir eine große Rolle spielen, nicht unbedingt in der Abbildung der Aktualität, aber in den Zusammenhängen. Da bereiten wir ganz viele Dinge vor, die Richtung Bundestagswahl zum Tragen kommen und darüber hinaus Teil unseres Angebots bleiben. „Jäger & Sammler“ geht in diese Richtung. Es gibt einige Grundlagen, aber wir sind längst nicht da, wo wir hinwollen. Wir sehen uns nicht als diejenigen, die Aktualität abbilden, da sind andere besser und schneller, und glauben, dass die Zielgruppe sich an anderen Stellen informiert, aber dass wir die Einordnung, Hintergründe u. ä. liefern, sehen wir klar als unsere Aufgabe. VG: Mit „Hochkant“ und „Novi“ habt ihr aber auch zwei Nachrichtenformate. Florian Hager: Novi ist an der Tagesschau angedockt, Hochkant an die Nachrichtenredaktion vom RBB. Wir wollen nicht journalistisch eigene Wege gehen, sondern rekurrieren auf die bestehende Nachrichtenkompetenz von ARD und ZDF. Unsere Frage ist: Wie schaffen wir die technische, aber auch formale, sprachliche Übersetzung, dass wir mit Nachrichten die junge Zielgruppe erreichen? Wie kommt die Nachricht zum Nutzer und nicht: Wie verlange ich vom Nutzer, dass er zur Nachricht kommt? VG: „Germania“, „Headlinez“, „Informr“ und „Y-Kollektiv“ mit ihren Kommentaren und Diskussionen über aktuelle Themen würde ich auch der politischen Bildung zuzählen. Zu Medienkompetenz – ein weiterer Aspekt des Bildungsauftrags, gerade im Internet – habe ich bislang nur „B.A.“ gefunden. Da werden zwar DIY-Rapvideo-Tutorials und ironische „How-tos“ angekündigt und Challenges für die Remix-Compilation durchgeführt, aber wirklich Lehrreiches findet sich da noch nicht. Florian Hager: Da sind wir am Ausprobieren. Wir glauben, dass Medienkompetenz die einzige Möglichkeit ist, die Zielgruppe zu befähigen, überhaupt Medien konsumieren zu können und einzuordnen, was woher kommt. Wir merken ganz stark, dass der Bewegtbildkonsum im Netz ansteigt, aber dass es keine Relevanz mehr hat, von welcher Quelle das kommt. Wir sind noch klassisch in der journalistischen Denke, wir müssen die Quellen angeben. Im Netz ist das immer mehr egal. Das ist eine neue Voraussetzung, was die Medienkompetenz betrifft. Ich glaube von vielen in der Zielgruppe, dass sie wissen, was sie gucken, ohne es selbst beschreiben zu können, dass sie Filter haben, das einordnen können, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ihnen noch mehr Medienkompetenz zu vermitteln, damit sie sich in der Welt zurecht finden können, nicht nur im Video, sondern auch offline. Da sind wir ganz am Anfang. Wir wollen ein Talentnetzwerk aufbauen, mit dem wir Talente begleiten. Das Wichtigste ist, dass wir den Kontakt zum Nutzer suchen, dass wir physisch rausgehen, angucken, wie nutzen die ihre Handys, wie verändert sich die Nutzung der Plattformen, was machen die da? Zum anderen wollen wir bei Veranstaltungen vor Ort sein und in Austausch kommen. (Interview 23.03.2017) |
Der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag in Österreich
Vorläufer des Österreichischen Rundfunks (ORF) war die 1924 gegründete Radio Verkehrs AG. Nach Anschluss Österreichs an Deutschland wurde sie 1938 der deutschen Reichsrundfunkgesellschaft unterstellt. Nach Kriegsende 1945 sendeten die Besatzungsmächte in ihrer jeweiligen Zone eigene Programme.
Mit dem Abzug der Alliierten 1955 wurden die bestehenden Sender als Österreichisches Rundspruchwesen vereinigt, aus der Ende 1957 die Österreichischer Rundfunk GmbH entstand. Der Hörfunk startete mit einem nationalen und einem regionalen Programm auf Mittelwelle, was wegen der gebirgigen Topografie des Landes Probleme aufwarf. Zunächst wurden Bereiche im Funkschatten mit einer großen Zahl Mittelwelle-Kleinsendern ausgeleuchtet, dann wurde das UKW-Sendernetz ausgebaut. 1955 begann auch die regelmäßige Ausstrahlung von Fernsehversuchsprogrammen an einigen Wochentagen, bis es sich ab Jänner 1957 über die gesamte Woche erstreckte. Die Zahl der gemeldeten Fernsehteilnehmer stieg von 50.000 im Jänner 1959 (bei 7 Millionen Einwohnern) auf 100.000 im Dezember 1959, 500.000 im März 1964 und eine Million im Februar 1968 (bei nun 7,5 Millionen Einwohnern). 1961 begann die probeweise Ausstrahlung eines zweiten Fernsehprogramms, 1965 die ersten Farbfernsehversuche (vgl. Dokumentationsarchiv Funk, Die historische Entwicklung des Rundfunks in Österreich; Uni-Wien, Geschichte Online: Geschichte der Hörfunknachrichten und Geschichte der Fernsehnachrichten.).

In den Anfangsjahren betrachteten die Parteien der großen Koalition den Rundfunk als ihr Sprachrohr. Die Direktoren der Österreichischer Rundfunk GmbH wurden im Parteienproporz besetzt, wobei der Hörfunk schwarz (ÖVP) besetzt war und das Fernsehen rot (SPÖ). Streitfälle wurden statt in den zuständigen Instanzen in den jeweiligen politischen Gremien geklärt. Die Kritik am politisierten Rundfunk wuchs, vor allem unter den Presseverlagen. Als dem Kurier, der damals größte österreichische Tageszeitung, ein Geheimabkommen der Koalitionsregierung über die Besetzung der Leitungsposten im Rundfunk zugespielt worden war, startete ihr Chefredakteur, Hugo Portisch, eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren für einen parteiunabhängigen Rundfunk. Andere Zeitungen schlossen sich an. Dass über die notwendigen Unterschriften hinaus 370.000 Menschen unterschrieben, zeigt das große Interesse. Die Politiker von SPÖ und ÖVP verfolgten ihre eigene Entmachtung nur zögerlich. Ein Rundfunkkomitee, das binnen eines Jahres bis Juni 1964 Vorschläge für eine Rundfunkreform ausarbeiten sollte, endete ohne Ergebnis. Das eigentliche Volksbegehren, das erste der neuen Republik, fand in der Woche vom 5. Oktober 1964 statt. Der ORF verschwieg es in seinen Sendungen. 832.353 Menschen unterschrieben die Forderung nach „Entpolitisierung des Rundfunks, Verhinderung des Proporzes, mehr Unabhängigkeit“.
Das Rundfunkbegehren wurde darauf hin an den Nationalratsausschuss verwiesen, der es verschleppte. 1966 kam es zur Auflösung des Parlaments und dem Rücktritt des Kabinett Klaus. Im Wahlkampf versprach die ÖVP, das Volksbegehren umzusetzen, wenn sie die Mehrheit erhielte. Die erhielt sie tatsächlich, und so sah sich die ÖVP-Alleinregierung unter Bundeskanzler Josef Klaus (1966-1970) gezwungen, ihr Versprechen einzuhalten, allerdings nicht ohne den Text des Volksbegehrens bezüglich der Besetzung der zuständigen Gremien zu ihren Gunsten zu verändern. Am 8. Juli 1966 wurde schließlich das österreichische Rundfunkgesetz im Nationalrat beschlossen, das am 1. Jänner 1967 in Kraft trat. Auf dieser Grundlage wurde 1967 der ORF in seiner heutigen Form gegründet. Die Novellierung des Rundfunkgesetzes von 1974 überführte den ORF in eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit Programmauftrag. Die ORF-Gesetz-Novelle von 2001 wandelte ihn in eine Stiftung öffentlichen Rechts. Leitung und Kontrolle des ORF obliegen seither dem Stiftungsrat, der auch den Generaldirektor wählt. An die Stelle der HörerInnen- und SeherInnenvertretung ist ein Publikumsrat getreten.
Die Rundfunkfreiheit ist im österreichischen Verfassungsrecht verankert als Funktionsgrundrecht im Bundesverfassungsgesetz über die Unabhängigkeit des Rundfunks aus dem Jahr 1974 und als individuelles Grundrecht in Art. 13 StGG, Art. 11 der europäischen Grundrechtecharta sowie in Art. 10 der EMRK. Der Auftrag des ORF wird im ORF-Gesetz formuliert und in Angebotskonzepten, Berichten und Plänen konkretisiert und einer Prüfung ex ante und ex post unterzogen. Anders als das föderale deutsche und wie das britische System ist der österreichische Rundfunk nicht nur in der Übertragungstechnik (versorgt durch die ORS), sondern auch im journalistisch-redaktionellen Betrieb zentral organisiert. Wie in Großbritannien spielen die Landesstudios in den neun Bundesländern sowie Angebote für alle Volks- und Sprachgruppen eine wichtige Rolle für den ORF.
Die Rechtsaufsicht über den ORF obliegt der Regulierungsbehörde für Rundfunk und audiovisuelle Medien, der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria, vgl. KommAustria-Gesetz (KOG)). Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben betreibt die KommAustria zusammen mit den Regulierungsbehörden für Telekommunikation und für Post die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH).
Wie in Großbritannien sind die Rundfunkgebühren in Österreich an den Besitz von Radio- und TV-Empfangsgeräten geknüpft. Die reine Internet-Nutzung von ORF-Angeboten ist nicht gebührenpflichtig, entschied der Verwaltungsgerichtshof 2015, da Livestreaming nicht unter den Rundfunkbegriff falle (Presse 20.07.2015).
Das Ende des Rundfunkmonopols des ORF begann 1993 mit der Verabschiedung des Regionalradiogesetzes. Das duale System entstand somit aus der Kombination von öffentlich-rechtlichem mit zivilgesellschaftlichem Rundfunk. In den 1920er Jaren gab es in Österreich bereits Illegale Arbeiterradiosender. Ende der 1970er entstand europaweit eine neue Bewegung von Freien Radios. Hintergrund war einerseits die Ausdifferenzierung der sozialen Bewegungen, andererseits die Debatte über die „Liberalisierung“ des Rundfunks. Ab 1985 gab es erste Vereinbarungen zwischen ORF und dem Verband der Zeitungsherausgeber (VÖZ), die zu ersten Pilotprojekten und Plänen für eine Kooperation im Privatradiogeschäft führten.
In den 1980ern verstärkten sich sowohl die Forderung nach Zugang zum Äther wie die Aktivitäten von Piratenradios in Österreich. Die österreichischen Radioinitiativen wurden dabei von der Föderation europäischer freier Radios (FERL) unterstützt. Anfang der 1990er verstärkten die Radioinitiativen und FERL ihre politischen Aktivitäten, begleitet von einer neuen Welle illegaler Sendetätigkeit. Ab 1987 wurden wiederholt Anträge auf Sendelizenz eines nichtkommerziellen Radios gestellt. Ihr Scheitern führte 1989 zu einer Beschwerde gegen die Republik Österreich beim Europäischen Gerichtshof. Der forderte in seiner Entscheidung vom November 1993 die Aufhebung des Sendemonopols des ORF und die Zulassung privater Rundfunkanbieter. Kurz zuvor, im Juli 1993, hatte das Parlament mit den Stimmen der ÖVP-SPÖ-Regierung das Regionalradiogesetz (RRG) verabschiedet. Zum Jänner 1994 wurden zehn Frequenzen für regionalen Hörfunk ausgeschrieben. Als ein Jahr später die Vergabeentscheidungen bekanntgegeben wurden, folgte eine Welle von Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof, darunter die der freien Radioinitiativen, die fast alle leer ausgegangen waren. Das Verfassungsgericht kassierte das Regionalradiogesetz. In seiner novellierten Fassung trat es im Mai 1997 in Kraft. Noch im selben Jahr erfolgte die Lizenzvergabe: zehn Regionalradios sowie 43 lokale Anbieter, davon acht freie Radios, erhielten den Zuschlag (Dorer 2004).
Ebenfalls 1997 wurde das Kabel- und Satelliten-Rundfunkgesetz verabschiedet, das erstmals private Fernsehveranstalter auf diesen beiden Übertragunswegen zuließ. An seine Stelle trat 2001 das Privatfernsehgesetz, das nun auch privates terrestrisches Fernsehen zuließ.
Über den öffentlich-rechtlichen Auftrag unter der ORF-Stiftung hinausgehende kommerzielle Tätigkeiten des ORF sind strikt zu trennen, durch Tochtergesellschaften wahrzunehmen und dürfen nicht unter der Marke „ORF“ angeboten werden (ORF-G § 8a bis 9b). Für den Schulunterricht bestimmte Radiosendungen wurden in Österreich seit 1932 und vermehrt seit den 1950er Jahren ausgestrahlt. 1984 wurde der Schulfunk durch andere Sendungen abgelöst (Radiokolleg, Fremdsprachensendungen usw.).
Das Schulfernsehen begann mit Vorversuchen 1959. 1962 wurde ein wöchentlicher Schulfernsehtag eingeführt. Offiziell gegründet wurde es von Helmut Zilk, den der konservative neue Generalintendant des ORF Gerd Bacher 1967 zum Fernsehdirektor machte. Der Pädagoge und undoktrinäre Sozialdemokrat Zilk begründete in dieser Funktion das Schulfernsehen, die Sendungen „In eigener Sache“ und „Auslandsecho“ sowie das 2. Fernsehprogramm (Austria-Forum: Schulfunk und Schulfernsehen; Wikipedia: Helmut Zilk; Wikipedia: Gerd Bacher). Star des Schulfernsehens war Lisa Schüller, die von 1974 bis 1992 den Russischsprachkurs „Russisch für Anfänger“ moderierte. Schüller hatte als Dolmetscherin für Zilk gearbeitet, der sie fürs Fernsehen entdeckte. Der 26-teilige Sprachkurs „Russisch für alle“ wurde bis 2007 regelmäßig auf 3Sat wiederholt (Presse 29.11.2010).
1992 wurde die Produktion von Schulfunksendungen durch den ORF eingestellt. Als Begründung werden die hohen Kosten genannt, aber auch urheberrechtliche Bedenken gegen die pädagogische Nutzung des gesamten Fernsehprogramms mittels Videorecorder (Austria-Forum: Schulfunk und Schulfernsehen). Allerdings hatte der OGH mit Urteil vom 18.09.1991 entschieden, dass der Republik Österreich mit ihren Organen ORF und Staatliche Hauptstelle für den Bildungsfilm die Nutzung von für das Schulfernsehen produzierten Sendungen allenfalls untersagt werden könne, als diese über den nichtkommerziellen Bereich der Schule, Jugend- und Erwachsenenbildung hinausginge. Man darf vermuten, dass auch die Hersteller kommerzieller Bildungsmedien eine Rolle dabei gespielt haben. Seit 1992 versorgt das heutige Medienservice des Bundesministeriums für Bildung – in Zusammenarbeit mit dem ORF – die Produktion sowie den Verkauf und Verleih von audiovisuellen Medien für den nichtkommerziellen Bildungsbereich. Zudem betreibt die Universitätsbibliothek Wien im Auftrag des Medienservice seit 2003 die Plattform Bildungsmedien.tv, die nach eigenen Angaben derzeit um die 2000 AV-Medien sowie 300 Begleitmaterialien und Arbeitsblätter per Streaming in österreichische Schulen bringt. Der Zugang ist mit Ausnahme ausgewählter Materialien und Begleithefte beschränkt auf Personen, die in österreichischen Schulen oder Erwachsenenbildungseinrichtungen tätig sind. Mit dem Ende des Schulfunks beschränkt sich der Bildungsauftrag des ORF seit 1992 auf einen Bildungsbegriffe im weiten Sinne.
Die Digitalisierung der Übertragungswege begann 1998 mit dem Sendebetrieb via Satellit, der von Beginn an digital war. Die Satellitenplattform ORF DIGITAL steht aufgrund des Urheberrechts von TV-Inhalten mit Ausnahme der Radioprogramme des ORF sowie ORF 2 EUROPE ausschließlich in verschlüsselter Form zur Verfügung. Das terrestrische TV wurde von 2006 bis 2011 auf DVB-T umgestellt. Die Umstellung auf DVB-T2 läuft im Zeitraum 2014 – 2017. Als Codec verwendet das österreichische DVB-T2 h.264, während beim deutschen System das neue HEVC/h.265 eingesetzt wird. Bei der digitalisierten Verwaltung sehen Experten Österreich der Bundesrepublik um zehn Jahre voraus (SZ 14.06.2016).
Das ORF-Gesetz
Das ORF-Gesetz (aktuell i.d. Fassung der letzten Änderung vom 31.07.2017) definiert den öffentlich-rechtliche Auftrag in den §§ 3 bis 5. Dieser setzt sich aus einem Versorgungsauftrag, einem öffentlich-rechtlichen Kernauftrag sowie weiteren besonderen Aufträgen zusammen. Der Online-Auftrag und mit ihm die Umsetzung des von der EU-Kommission vorgeschriebenen Amsterdam-Tests, der in Österreich Auftragsvorprüfung (§ 6 bis 6c ORF-G) heißt und dem britischen Public Value Test und dem deutschen Drei-Stufen-Test gleicht, mit Angebotskonzept, Berichtspflichten und Qualitätssicherungssystem wurde in der ORF-G-Novelle von 2010 eingeführt. Im selben Zuge wurde die KommAustria als Rechtsaufsicht und Herrin der Auftragsvorprüfung eingesetzt.
- Versorgungsauftrag (§ 3 ORF-G)
Der ORF hat die berechtigten Bewohner des Bundesgebietes österreichweit mit drei Radio- und zwei TV-Programmen, sowie neun bundeslandweit empfangbaren Radioprogrammen zu versorgen, mindestens terrestrisch, auch digital (DVB-T), auch über Satellit, „nach Maßgabe der technischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit“. Er kann diese Programme gleichzeitig mit der Ausstrahlung sowie bis zu 24 Stunden danach unverändert zeitversetzt ohne Speichermöglichkeit online bereitstellen. Zum Versorgungsauftrag zählen auch Teletext, ein UKW-Auslandsdienst, Hörfunkprogramme auf Mittelwelle sowie Spartenprogramme für Sport (§ 4b) und für Information und Kultur (§ 4c; „insbesondere … Informations-, Diskussions-, Dokumentarsendungen, Magazine und Übertragungen von Kulturereignissen“ und „ein umfassendes Angebot von Sendungen mit Informations- oder Bildungscharakter sowie von Kultursendungen“) sowie ein Fernsehprogramm für das europäische Publikum (§ 4d).
- Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag (§ 4 ORF-G)
Der ORF hat durch die Gesamtheit seiner Programme und Angebote einen Katalog von Leistungen zu erbringen, die fast ausnahmslos Aspekte des Bildungsauftrags zum Ausdruck bringen. In Absatz 1 werden im engeren Sinne genannt:
13. die Verbreitung und Förderung von Volks- und Jugendbildung unter besonderer Beachtung der Schul- und Erwachsenenbildung.
Im weiteren Sinne:
1. die umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Fragen;
2. die Förderung des Verständnisses für alle Fragen des demokratischen Zusammenlebens;
3. die Förderung der österreichischen Identität im Blickwinkel der europäischen Geschichte und Integration;
4. die Förderung des Verständnisses für die europäische Integration;
5. die Vermittlung und Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft;
14. die Information über Themen der Gesundheit und des Natur-, Umwelt- sowie Konsumentenschutzes unter Berücksichtigung der Förderung des Verständnisses über die Prinzipien der Nachhaltigkeit.
15. die Förderung des Interesses der Bevölkerung an aktiver sportlicher Betätigung;
16. die Information über die Bedeutung, Funktion und Aufgaben des Bundesstaates sowie die Förderung der regionalen Identitäten der Bundesländer;
17. die Förderung des Verständnisses für wirtschaftliche Zusammenhänge;
18. die Förderung des Verständnisses für Fragen der europäischen Sicherheitspolitik und der umfassenden Landesverteidigung.
Dabei sind die Interessen aller Hörer und Seher, insbesondere aller Altersgruppen, von behinderten Menschen, Familien und Kindern sowie der Gleichberechtigung von Frauen und Männern angemessen zu berücksichtigen.
§ 4 Abs 3 behauptet, der ORF stehe „im Wettbewerb mit den kommerziellen Sendern“ und habe „in Inhalt und Auftritt auf die Unverwechselbarkeit des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks zu achten.“ Dafür hat er Programme von hoher Qualität (§ 4 Abs. 4) und anspruchsvolle Inhalte gleichwertig im Programm, jedenfalls in den Hauptabendprogrammen (§ 4 Abs. 3), eine objektive Auswahl und Vermittlung von Informationen zu bieten und die Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen zu berücksichtigen. Journalistische oder programmgestaltende Mitarbeiter werden zu Unabhängigkeit verpflichtet „von Staats- und Parteieinfluss, aber auch Unabhängigkeit von anderen Medien, seien es elektronische oder Printmedien, oder seien es politische oder wirtschaftliche Lobbys.“
Unter „Qualitätssicherungssystem“ (§ 4a) wird dem Generaldirektor des ORF aufgetragen, Kriterien und Verfahren zur Sicherstellung der Erfüllung der Ziele des öffentlich-rechtlichen Kernauftrages zu definieren: „Unverwechselbarkeit des Inhalts und des Auftritts (§ 4 Abs. 3), der in der Regel anspruchsvollen Sendungsgestaltung in den Hauptabendprogrammen (§ 4 Abs. 3) und der hohen Qualität in den Bereichen Information, Kultur und Wissenschaft (§ 4 Abs. 4)“
Das Qualitätssicherungssystem muss vom Stiftungsrat genehmigt werden und kann vor der Regulierungsbehörde angefochten werden. Dabei sind Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit aller programmgestaltenden Mitarbeiter und der Direktoren und Landesdirektoren zu berücksichtigen, es ist ein unabhängiger Sachverständiger zu beauftragen und die Empfehlungen des Publikumsrates zu hören. Grundlage bilden Jahresberichte, langfristige Programmpläne und Jahressendeschemen des ORF, eine Programmstrukturanalyse für TV und Radio, die die Einhaltung der quotierten Anteile der einzelnen Programmkategorien überprüft (mit einer zulässigen „Schwankungsbreiten von bis zu +/- 5 Prozentpunkten für jeweils einen im Durchschnitt von vier Jahren zu erreichenden Programmanteil“), „ein kontinuierliches repräsentatives und qualitatives Publikumsmonitoring auch unter Beiziehung externer Fachexperten aus den jeweiligen Bereichen“ sowie regelmäßig durchgeführte, repräsentative Teilnehmerbefragungen und andere empirische Forschung durch ORF, seine Töchter oder Dritte, sowie die Leistungen der Abteilung für Public Value (s. u.).
- Besonderer Auftrag für ein Online-Angebot (§ 4e ORF-G)
Das Internet erscheint im ORF-G als primärer Kanal für die Unternehmenskommunikation. So hat der ORF sein Qualitätssicherungssystem incl. der dazu erstellten Studien und Teilnehmerbefragungen, Beschlüsse des Stiftungsrates und des Publikumsrates (§ 4a Abs. 7) sowie seine Angebotskonzepte auf seiner Website zu veröffentlichen (§ 5a). Der ORF muss Sportrechte anderen Rundfunkveranstaltern anbieten und hat auch dafür Informationen über solche Senderechte „rechtzeitig online zur Verfügung zu stellen“ (§ 31b Abs 2).
Im Vergleich dazu, aber auch zur Situation in UK und DE, ist das dem ORF zur eigentlichen Auftragserfüllung online Erlaubte beschränkt. Das betrifft z. B. die Verweildauern. Sendungsunabhängige Inhalte und „eigens für mobile Endgeräte gestaltete Angebote“ sind untersagt. Auch auf Drittplattformen darf der ORF seine Inhalte bislang nicht stellen.
Der ORF hat zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags (§ 4) auch ein Online-Angebot bereitzustellen. Dieses beinhaltet die folgenden vier Elemente, die jeweils erst nach Erstellung eines Angebotskonzeptes (§ 5a) bereitgestellt werden dürfen. Eine Auftragsvorprüfung (§§ 6 bis 6c) für bestehende Online-Angebote braucht es nicht, es sein denn, sie werden auf eine neue oder wesentlich geänderte Weise kommerziell verwertet.
Die vier Elemente des Online-Auftrags sind:
1. Information über die Programme und Angebote des ORF
2. Eine tagesaktuelle Überblicksberichterstattung
Diese besteht aus Text und Bild und kann einzelne ergänzende Audio-, audiovisuelle und interaktive Elemente sowie Podcasts (Audio und Video) umfassen. Die einzelnen Elemente der Berichterstattung sind nur für die Dauer ihrer Aktualität, längstens jedoch sieben Tage ab Bereitstellung zum Abruf über die Plattform des Österreichischen Rundfunks bereitzustellen. Die Bereitstellung älterer Elemente der Berichterstattung, die in unmittelbarem Zusammenhang zur aktuellen Berichterstattung stehen, ist für die Dauer der Veröffentlichung der aktuellen Berichte zulässig. Die Berichterstattung darf nicht vertiefend und in ihrer Gesamtaufmachung und -gestaltung nicht mit dem Online-Angebot von Tages- oder Wochenzeitungen oder Monatszeitschriften vergleichbar sein und kein Nachrichtenarchiv umfassen. Gesonderte Überblicksberichterstattung auf Bundesländerebene ist zulässig, jedoch auf bis zu 80 Tagesmeldungen pro Bundesland pro Kalenderwoche zu beschränken. Eine umfassende lokale Berichterstattung ist unzulässig.
3. Sendungsbegleitende Inhalte
Dabei handelt es sich um Informationen über die Sendung selbst und um „Informationen zur unterstützenden Erläuterung und Vertiefung der Sendungsinhalte, einschließlich Audio- und audiovisueller Angebote und ergänzender interaktiver Elemente sowie Podcasts (Audio und Video), soweit dabei auf für die jeweilige Hörfunk- oder Fernsehsendung bzw. Sendereihe verfügbare Materialien und Quellen zurückgegriffen wird und dieses Angebot thematisch und inhaltlich die Hörfunk- oder Fernsehsendung unterstützend vertieft und begleitet. Sendungsbegleitende Inhalte sind jeweils durch Angabe der Bezeichnung und des Ausstrahlungsdatums der Hörfunk- oder Fernsehsendung zu bezeichnen, die sie begleiten. Sendungsbegleitende Angebote dürfen kein eigenständiges, von der konkreten Hörfunk oder Fernsehsendung losgelöstes Angebot darstellen und nicht nach Gesamtgestaltung und -inhalt dem Online-Angebot von Zeitungen und Zeitschriften entsprechen; insbesondere darf kein von der Begleitung der konkreten Hörfunk- oder Fernsehsendungen losgelöstes, vertiefendes Angebot in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Chronik, Kultur und Wissenschaft (einschließlich Technologie), Sport, Mode- und Gesellschaftsberichterstattung bereitgestellt werden. Sendungsbegleitende Inhalte dürfen nur für einen dem jeweiligen Sendungsformat angemessenen Zeitraum bereitgestellt werden, das sind längstens 30 Tage nach Ausstrahlung der Sendung bzw. bei Sendereihen 30 Tage nach Ausstrahlung des letzten Teils der Sendereihe. Die Bereitstellung von sendungsbegleitenden Inhalten in einem angemessenen Zeitraum vor Ausstrahlung der jeweiligen Sendung ist zulässig, soweit der konkrete Sendungsbezug gewahrt bleibt.
4. Ein Abrufdienst für die ausgestrahlten Sendungen
Hier sind nur Sendungen zulässig, die vom ORF selbst oder in seinem Auftrag, sei es auch in Zusammenarbeit mit Dritten, hergestellt wurden. Die Bereitstellung zum Abruf hat ohne Speichermöglichkeit (ausgenommen Podcasts) und für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen nach Ausstrahlung, im Fall von Sportbewerben im Sinne von § 4b Abs. 4 bis zu 24 Stunden nach Ausstrahlung zu erfolgen. Archive mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten dürfen nach Maßgabe des Angebotskonzeptes (Abs.5) auch zeitlich unbefristet zum Abruf bereitgestellt werden.
Der folgende § 4f besagt, der ORF habe „weitere Online-Angebote bereitzustellen, die einen wirksamen Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags (§ 4) leisten.“ Diese werden nicht näher spezifiziert. Wohl aber folgt eine Negativliste der Online-Angebote, die nicht im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden dürfen. Darunter finden sich neben Anzeigenportalen, Preisvergleichsportalen, Partnerbörsen, Erotikangeboten, Spiele ohne Sendungsbezug, Klingeltönen auch „Foren, Chats und sonstige Angebote zur Veröffentlichung von Inhalten durch Nutzer“, sofern es sich nicht um „redaktionell begleitete, nicht-ständige Angebote“ mit Bezug zu österreichweit gesendeten Fernseh- oder Hörfunkprogrammen handelt. „Voraussetzung für die Veröffentlichung von Nutzerinhalten in solchen Angeboten ist die Registrierung des Nutzers unter Angabe von Vorname und Familienname und der Wohnadresse.“ Schließlich verbietet der Paragraph dem ORF „eigens für mobile Endgeräte gestaltete Angebote“.
Ein neues Angebot des ORF oder eine wesentliche Änderung eines bestehenden Angebots ist einer Auftragsvorprüfung (§ 6 bis 6c ORF-G) zu unterziehen, die dem britischen Public Value Test und dem deutschen Drei-Stufen-Test gleicht. Dazu hat der ORF in einem Angebotskonzepte (§ 5a) den gesetzlichen Auftrag des Angebots zu konkretisieren und detailliert zu begründen, weshalb das neue Angebot zur Erbringung des Kernauftrags sowie der weiteren Aufträge zweckmäßig erscheint. Weiters muss der ORF die Finanzierung sowie die voraussichtlichen Auswirkungen des neuen Angebotes auf den Markt und auf die Angebotsvielfalt für Seher, Hörer oder Nutzer darstellen.
Diese Dokumente sind der Regulierungsbehörde KommAustria, der Wirtschaftskammer Österreich und der Bundesarbeitskammer zu übermitteln sowie auf der Website des ORF leicht auffindbar, unmittelbar und für die Dauer der Stellungnahmefrist von mindestens sechs Wochen zugänglich zu machen. Das aufgrund der Stellungnahmen ggf. geänderte Angebotskonzepts legt der ORF der Regulierungsbehörde zur Genehmigung vor. Diese gibt den Vorgang zur Stellungnahme an ihren Beirat (§ 6c), „Public-Value-Beirat“ benannt, der sich aus publizistischer Sicht zu Auftragserfüllung und Angebotsvielfalt für die Seher, Hörer und Nutzer durch das neue Angebot äußert, und an die Bundeswettbewerbsbehörde zu den voraussichtlichen Auswirkungen des neuen Angebots auf die Wettbewerbssituation anderer in Österreich tätiger Medienunternehmen (§ 6a). Externe Gutachter wie in Deutschland sind nicht vorgeschrieben.
Ist nach alldem zu erwarten, dass das neue Angebot zur Erfüllung von Kernauftrag und sozialen, demokratischen und kulturellen Bedürfnissen der österreichischen Bevölkerung beiträgt, dass es die Angebotsvielfalt für Seher, Hörer und Nutzer erhöht und dass es keine negativen Auswirkungen auf den Markt haben wird, wohl aber positive (durch journalistische oder technische Innovationen) – kurz: wenn es einen Mehrwert oder Public Value verspricht, ist das neue Angebot von der Regulierungsbehörde zu genehmigen. Bis heute sind vier Auftragsprüfungen abgeschlossen worden, aktuell laufen vier Prüfungen, darunter eine neue Radiothek und ein ORF-Kanal auf Youtube.
Bildung
Im ORF-Gesetz finden sich nur wenige Aussagen zu Bildung. Dafür aber an zentralen Stellen. Einer der 19 Kernaufträge lautet: „die Verbreitung und Förderung von Volks- und Jugendbildung unter besonderer Beachtung der Schul- und Erwachsenenbildung“ (§ 4 Abs. 1 Z 13 ORF-G). Auch unter Programmgrundsätze heißt es: „Der Österreichische Rundfunk hat im Dienst von Wissenschaft und Bildung zu stehen.“ (§ 10 Abs. 9 ORF-G) Der ORF hat Sorge zu tragen, dass der Hauptanteil der Sendezeit seiner Fernsehprogramme (auf die allerdings Nachrichten, Sportberichte, Spielshows und Werbe- und Teletextleistungen nicht angerechnet werden), europäischen Werken in den Bereichen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung vorbehalten bleibt (§ 11 ORF-G). Schließlich steht auch das Satellitenprogramm für das europäische Publikum unter der Vorgabe, dass es „vorwiegend aus Informations-, Bildungs- und Kultursendungen sowie anspruchsvoller Unterhaltung besteht und geeignet ist, Österreich in Europa darzustellen“ (§ 4d ORF-G).
ORF-Generaldirektor Wrabetz erläuterte:
„Es gibt im Gesetz keinen expliziten Bildungsauftrag, wohl aber umfasst der Programmauftrag diverse Aspekte, die ohne Zweifel mit der – insbesondere politischen – Bildung zu tun haben. So z. B. die Verpflichtung, für umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen und für die Förderung des Verständnisses für alle Fragen des demokratischen Zusammenlebens zu sorgen.“ (in Naderhirn 2009: 25)
Mitglieder des Stiftungsrates haben eine einschlägige Vorbildung oder Berufserfahrung vorzuweisen und über Kenntnisse des Medienmarktes zu verfügen oder sie müssen „sich auf Grund ihrer bisherigen Tätigkeit im Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst oder Bildung hohes Ansehen erworben haben.“ Angestellte von Rechtsträgern der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit im Bereich der politischen Parteien dürfen jedoch nicht zum Mitglied des Stiftungsrats bestellt werden (§ 20 ORF-G). Auch dem Publikumsrat dürfen sie nicht angehören (§ 28 Abs. 2 Z 7), die Rechtsträger stellen jedoch ein Mitglied (§ 28 Abs. 3 Z 5). Für die weiteren Mitglieder des Publikumsrates hat der Bundeskanzler Vorschläge u. a. aus den Bereichen Hochschulen, Bildung, Jugend, Schüler und Eltern bzw. Familien einzuholen (§ 28 Abs. 4). Der ORF hat Beiräte für Gesundheit, Kultur und Volksgruppen, nicht aber für Bildung.
Public Value
Der ORF hat unter den europäischen Öffentlich-Rechtlichen am intensivsten den durch die BBC gefilterten Mooreschen Public Value-Begriff aufgegriffen. In dem Schritt flossen eine Reihe Entwicklungen zusammen:
- der wachsende Druck von kommerziellen Medien seit den 1990ern Jahren;
- die Beihilfeverfahren des EU-Kommission gegen ÖRM, seit Beschwerden österreichischer Privatmedienverbände in den Jahren 2004 und 2005 auch gegen den ORF;
- die angespannte finanzielle Lage des ORF (sinkende Werbeeinnahmen, Kosten u. a. der Umstellung auf HDTV und DVB-T, erwartete Verluste des ORF für das Jahr 2008, die erst auf 60 Millionen Euro, wenig später auf 100 Millionen Euro beziffert wurden, ein Bericht des Rechnungshofes zum Jahresbeginn 2009, der dem ORF ein hohes Spar- und Reformpotenzial attestierte, daraus folgende Pläne zur Erhöhung der ORF-Gebühren seit 2007, die im Februar 2008 mit 9,4% beschlossen wurden) (Bartenberger 2010: 91);
- der stärkere politische Druck durch die ÖVP/FPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (2000–2006);
- die Novellierung des ORF-Gesetzes von 2001, die die ORF-Stiftung und den Publikumsrat einführte und zur Bestellung von Monika Lindner zur neuen ORF-Generaldirektorin durch den Stiftungsrat im Dezember 2001 führte. Unter der ÖVP-nahen vormaligen Landesintendatin des ORF Niederösterreich Lindner und weiterem Führungspersonal, wie dem 2002 neu bestellten Chefredakteur der Fernsehinformation Werner Mück, geriet der ORF in die Kritik, im Sinne der schwarz-blauen Regierung zu berichten.
- die große Koalition aus SPÖ und ÖVP, die nach der Nationalratswahl im Oktober 2006 im Jänner 2007 wieder die Regierung übernahm.
Vor diesem Hintergrund stand im August 2006 die Neuwahl des ORF-Generaldirektors an. Mit den Stimmen von jeweils der FPÖ, der FPÖ-Abspaltung BZÖ, der SPÖ und den Grünen nahestehender ORF-Stiftungsräte wurde Alexander Wrabetz nominiert. Der SPÖ-nahe Wrabetz, seit 2002 Finanzdirektor des ORF, war mit dem Programm angetreten, das öffentlich-rechtliche Profil zu schärfen und die Unabhängigkeit des ORF zu stärken: „Der ORF muss sich der kritischen Debatte über seine Rolle stellen und breite gesellschaftliche Kreise – insbesondere seine Kunden, die ZahlerInnen des Programmentgelts – in den Diskussionsprozess einbeziehen. Der durch gebührenfinanzierte Angebote geschaffene öffentlich-rechtliche Mehrwert muss nicht nur erlebbar, sondern auch messbar gemacht werden“ (nach Bartenberger 2010: 88 f.) Gegen die erneut angetretene Lindner wurde Wrabetz mit 20 von 35 möglichen Stimmen zum ORF-Generaldirektor gewählt.
Wrabetz’ Bezug auf das Public Value-Konzept der BBC ist unverkennbar. Nach seinem Amtsantritt im Jänner 2007 brachte er sogleich eine Stabsstelle „Public Value Kompetenzzentrum“ beim Generaldirektor auf den Weg. Diese nahm im Mai 2007 unter Leitung von Klaus Unterberger ihre Arbeit auf. Die ORF-Unternehmensklausur im Herbst 2007 wurde unter das Motto „Public Value: Erfolg durch Mehrwert“ gestellt. Im Dezember 2008 wurde schließlich der erste Public Value Bericht für die beiden vorangegangenen Jahre präsentiert. Darin definiert der ORF, ähnlich wie die BBC, Public Value in fünf Kategorien, jeweils mit Unterkategorien:
- Individueller Wert (Unterkategorien: Vertrauen, Service, Unterhaltung, Wissen, Verantwortung)
- Gesellschafts-Wert (Unterkategorien: Vielfalt, Orientierung, Integration, Bürgernähe, Kulturauftrag)
- Österreich-Wert (Unterkategorien: Identität, Wertschöpfung, Föderalismus)
- Internationaler-Wert (Unterkategorien: Europa-Integration, Globale Perspektiven)
- Unternehmens-Wert (Unterkategorien: Innovation, Transparenz, Kompetenz) (ORF 2008)
Das Public Value Kompetenzzentrum ist verantwortlich für einige Maßnahmen der Qualitätssicherung und der externen, internen und internationalen Kommunikation. Zentral dafür sind die jährlichen Public Value Berichte, die mehrfach ausgezeichnet wurden (Österreich Journal 22.08.1016). Daneben beauftragt das Zentrum Studien, gibt die Schriftenreihe „TEXTE – öffentlich-rechtliche Qualität im Diskurs“ heraus und veranstaltet regelmäßig das Dialogforum mit internationalen Gästen, Publikumsgespräche in ganz Österreich sowie hausinterne Diskussionen mit ExpertInnen und mit ORF-MitarbeiterInnen.
Wie der BBC wird auch dem ORF vorgeworfen, er verwende den Public Value-Begriff lediglich als PR-Konzept, als Worthülse, der es an Taten fehle. Für Bartenberger greift der Vorwurf in Anbetracht der Tätigkeiten des Kompetenzzentrums zu kurz. Er sieht die Arbeit des ORF mit dem Public Value-Konzept als einen Prozess, „der bereits einige Veränderungen hervorgerufen hat, dabei aber noch sehr am Anfang steht.“ (Bartenberger 2010: 78) In der Tat lässt die konsistente und prominente Verwendung des Public Value-Konzepts in der Innen- wie Außenkommunikation des ORF hoffen, dass sie zu einer Sensibilisierung vor allem für Responsivität und Rückkopplungen des Publikums und zu einem Kulturwandel hin zu einem offenen ORF führt.
Bildungsangebote
Die Produktion von Schulfernsehsendungen hatte der ORF 1992 eingestellt. Für Bildungsmedien ist seither das Bundesministerium für Bildung mit seinem heutigen Medienservice zuständig, das seit 2003 die Plattform Bildungsmedien.tv betreibt. Dieses geht auf die 1945 gegründete ehemalige Bundesstaatliche Hauptstelle für Lichtbild und Bildungsfilm (SHB) zurück. Die Zusammenarbeit zwischen Unterrichtsministerium und ORF regelt seit 1996 das Bildungsmedienabkommen. Demnach finanzieren ORF und Ministerium gemeinsam die Produktion von Filmen für den Unterricht an Schulen und Bildungseinrichtungen durch heimische Filmschaffende. Diese sind mindestens einmal jährlich eingeladen, ihre Projekte einzureichen. 2013 wurde das Bildungsmedienabkommen ausgeweitet (BMB 04.03.2013).
Der Schwerpunkt der formellen und informellen Bildungsangebote des ORF liegt im Radio bei Ö1. Dazu gehören:
- Ö1 Radiokolleg – 1984 trat das Radiokolleg an die Stelle des Schulfunks. Heute wird das Radiokolleg wochentags zwischen 9 und 10 Uhr ausgestrahlt und in verschiedenen Online-Angeboten genutzt.
- Ö1 macht Schule – Ein Gemeinschaftsprojekt von PH Wien, BMB und ORF/Ö1. Eine nach Fächern thematisch gegliederte Sammlung von unterrichtsgeeigneten Ö1 Radiosendungen für die 9. bis 13. Schulstufe, oft aus dem Radiokolleg, jeweils mit Begleitmaterialien für Lehrer und Links auf externe thematische Inhalte, zum Download und freier Nutzung im Unterricht. Die PH Wien bietet Weiterbildungsseminare für LehrerInnen an, damit diese das Angebot im Unterricht effektiv nutzen können.
- Ö1 Campus – Ist nicht etwa das Hochschulradio des ORF, sondern eine Medienkompetenzinitiative, eine Art Bürger- und Ausbildungskanal. Es geht auf den Mittelwellensender Radio 1476 zurück, auf dem der ORF seit März 1997 ein Mischprogramm aus Produktionen von Ö1, Volksgruppen-Sendungen, Regionalradioprogrammen sowie Sendungen von externen, zivilgesellschaftlichen Redaktionen wie Radio Afrika oder Freak Radio. Am 1. Jänner 2009 schaltete die ORS die Mittelwelle-Sendeanlagen aus Kostengründen ab. Radio 1476 wurde durch das Webradio oe1.ORF.at/campus ersetzt und das Programm von 6 auf 24 Stunden ausgeweitet. Heute wird das gesamte Programm von externen Initiativen bestritten, darunter die Demokratiewerkstatt des Parlaments, die sich an Kinder zwischen 8 und 14 richtet, das Studierenden-Radio der Uni Wien Radio Campus und das Schülerradio, das in Kooperation von BMB und ORF bereits seit 1998 sendet.
- Für eine junge Zielgruppe sind weiters zu nennen der 1995 gestartete ORF-Jugendkulturradiosender FM4, der einzige Independent-Pop-Sender in ganz Europa, dazu zweisprachig (deutsch und englisch) und und mit wenig Werbung, sowie die Netzkultursendung Ö1 Matrix.
Bei Bewegtbildinhalten sind neben zahlreichen Programminhalten im TV maßgeblich zu nennen:
- ORF-TVthek goes school – Eine Übersichtsseite mit thematischen Sammlungen von zeit- und kulturhistorischen Online-Videoarchivalien, die der ORF dauerhaft on Demand zur Verfügung stellen darf. Die Auswahl für den Unterricht bezieht sich vor allem auf österreichische Zeitzeugen und die Geschichten der Bundesländer. Weitere Online-Archive werden laufend erstellt.
- [M]eins – Eine Onlineplattform für die junge Zielgruppe zur Vertiefung der ORF-eins-Information und des ZiB-Magazins. Von ORF-1-Infochefin Lisa Totzauer entworfen, ist sie im Oktober 2015 gestartet. Einmal die Woche stellt das Infoteam zu einem Thema Videos, Fotos, Infografiken, Artikel und weiterführende Inhalte zusammen. Das erste Thema war: „Wer ist ‚Wir‘? Migration und Identität in Österreich“ (ORF 07.10.2015). Zu den ergänzenden Elementen gehörten z. B. die Poetry-Slammer Jonas und Hendrik, die per Videoblog ihren „Slam-Senf“ zum Thema abgeben. „Wir verlängern das Fernsehen ins Web“, sagte Totzauer zum Start (Standard 06.10.2015). Am 11.08.2017 ist die 92. Folge online gegangen: „Wenn eine Stadt verwaist“, eine Multimedia-Doku über die Kleinstadt Trofaiach in der Obersteiermark und ihre Projekte zur Wiederbelebung des Ortskerns. Die letzten 50 Folgen sind jeweils online (s. die vollständige List auf Wikipedia).
ORF-Online
Mit den beiden letztgenannten Projekten sind wir bereits beim Internet-Angebot des ORF. Die ORF-Website ist 1997 gestartet. ORF-Online besteht aus ORF.at mit diversen Subdomains, darunter:
- news.ORF.at – die meistbesuchte Nachrichtenwebsite Österreichs
- TVthek.ORF.at – der Abrufdienst des ORF
- iptv.ORF.at – unkommentiertes Video-Footage von aktuellen Ereignissen von APTN und EBU mit kurzem Text und Link auf den entsprechenden Bericht auf news.ORF.at.
- debatte.ORF.at – Foren zu aktuellen Themen. Die Debatten werden mit einigen Fragen und Links in andere Bereiche von ORF-Online eingeleitet. Wenn das Moderationsteam um Mitternacht die Arbeit beendet, wird die Debatte geschlossen. Nutzer müssen sich (nach §4f Abs. 2 Z 23 ORF-G) unter Angabe von Vor- und Nachname und der Wohnadresse registrieren.
- science.ORF.at – Wissenschaftsmagazin
- rataufdraht.ORF.at – Website der Kinder- und Jugendhotline
- help.ORF.at – Verbraucherberatung
Ferner betreibt der ORF 33 Twitter-Accounts, 55 Facebook-Seiten und 9 Instagram-Accounts.
Open Innovation
Unter dem Titel lassen sich eine Reihe Initiativen des ORF zusammenfassen, die auf die Förderung von Innovation und die Kooperation mit Institutionen und Zivilgesellschaft zielen. Viele der oft selbst innovativen Initiativen waren erfolgreich und vielversprechend, sind jedoch gleichwohl eingestellt worden, meist aus Kostengründen.
- Pixel, Bytes & Film – Ein Förderprogramm, das seit Jänner 2015 die bereits bestehenden Schienen „Neue Filmformate“ des Bundeskanzleramts (seit 2011) und „Artist in Residence“ von ORF III Kultur und Information (seit 2013) zu einer neuen Förderinitiative für multimediale Filmformate und Fernsehkunst verbindet. Sie richtet sich auf cross/transmediale Werke, wie Webisodes und neue Fernsehformate, serielle Erzählweisen von fiktionalen Stoffen, serielle und nichtlineare dokumentarische Formate, Crowdsourcing-Projekte und Usergenerated Movies sowie an österreichische wie internationale, etablierte und NachwuchskünstlerInnen. Die jeweils zwölf von der Jury gekürten Projekte erhalten 15.000 Euro sowie Unterstützung durch die Akademie der bildenden Künste Wien. Die Werke werden auf ORF-III ausgestrahlt und auf auf der Webseite Arte Creative gefeatured. Auch auf Vimeo ist das Projekt präsent. Bis Oktober 2017 lief die Bewerbungsfrist für die fünfte Staffel.
- Futurezone.ORF.at (Archiv) – War ein Online-Portal zu Fragen von Internet, Computer, Mobilfunk und Netzpolitik, 1999 als gemeinsames Projekt von Siemens Österreich und dem ORF gestartet. Neben ORF-Journalisten arbeiteten auch externe Experten bei Futurezone, wie der preisgekrönte investigative Journalist mit Technik-Schwerpunkt, Erich Möchel. Es wurde schnell zur angesehensten österreichischen Website zu diesem Themenbereich und – zumindest in den Augen der Netz-Community – zum besten Angebot des ORF. Doch der Erfolg brachte die österreichischen Tageszeitungen auf den Plan, die in dem beitragsfinanzierten Angebot einen unlauteren Wettbewerb zu ihren Onlineangeboten sahen. Und sie erkannten seine Schwäche: Futurezone begleitete keine lineare Sendung. Beobachter wie die Zeit (18.06.2010) und die taz (20.06.2010) sahen die Verleger am Werk als der Text der ORF-G-Novelle von 2010 publik und darin bestimmt wurde, dass das Angebot Futurezone.ORF.at mit 1. Oktober 2010 einzustellen ist. Im Juni 2010 startete eine Petition an den ORF, die Futurezone einer Genossenschaft zu übergeben. Im November 2010 wurde der Medienstaatssekretär Josef Ostermayer (SPÖ), stellvertretend für die gesamte österreichische Bundesregierung, mit dem Wolfgang Lorenz Gedenkpreis für internetfreie Minuten ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es: „Mit dem neuen ORF-Gesetz wurde die Chance vergeben, dem öffentlich-rechtlichen Medium Rahmenbedingungen zu geben, die es in Zukunft so positionieren, dass es seinem Auftrag gerecht werden kann. … Um sich die notwendige Zustimmung … bei den politischen Parteien und also Interessensgruppen zu sichern, wurde das qualitativ hochwertigste Internetangebot des ORF – nämlich die Futurezone – dem Verband österreichischer Zeitungsverleger, kurz VÖZ, geopfert.“ (ebd.) Durch die Gesetzesänderung war der ORF gezwungen, sich von der Futurezone zu trennen. Den Zuschlag erhielt schließlich die Tageszeitung Kurier, die den Betrieb mit einer neuen Redaktion seit dem 1. Oktober 2010 unter der Domain futurezone.at weiterführt.
- Ö1 Hörsaal (im Internet Archive) – War eine Open-Innovation-Initiative in Kooperation von uniko (Österreichische Universitätenkonferenz), Ö1 Wissenschaft und Innovation Service Network (ISN) mit dem Ziel, den Dialog zwischen Universitäten und BürgerInnen zu stärken. Letztere waren eingeladen, als Form von Crowdsourcing bis November 2014 Projekte einzureichen, die neue Impulse bei der Thematisierung und Bewältigung gesellschaftlicher Fragen und Herausforderungen setzen. Aus 251 Einreichungen wählte eine Jury im Jänner 2015 dreizehn sehr unterschiedliche Ideen und Projekte, die ein Preisgeld in Höhe von 800 Euro erhielten und jeweils in Kooperation mit einer der 12 teilnehmenden Universitäten umgesetzt wurden. Der Radiosender Ö1 begleitete das Projekt multimedial. Eine Analyse des Projekts durch Experten der WU Wien kam zu dem Schluss, der Wettbewerb sei „state-of-the-art“ gewesen und mit Crowdbewertung schon darüber hinausgegangen. Auch das Resümee der Unis sei positiv ausgefallen. Einer Fortsetzung dürfte nichts im Wege stehen, schrieb APA-Science (27.11.2015). Doch zu der ist es offenbar nicht gekommen.
- Ö1 Open Innovation Forum 2014 – Im Rahmen des Ö1-Schwerpunktes „Open Innovation“ lud die Ö1-Wissenschaftsredaktion im Frühjahr Hörer/innen ein, innovative Projekte zum Thema „Orte in Bewegung“ zu nominieren. Eingereicht wurden insgesamt rund 300 Projekte und Initiativen in österreichischen Gemeinden, Städten und Regionen, die dem Gemeinwohl dienen und ihre Umgebung durch soziale Innovationen verändern. Eine Fachjury und das Publikum hat daraus 16 Projekte ausgewählt, die im Rahmen der Ö1-Sommerserie „Innovation.Leben“ porträtiert wurden. Dabei arbeitet der ORF mit der zivilgesellschaftlichen Crowdfunding-Plattform Respekt.net zusammen, die den mit je 2.000 Euro dotierte „Social Innovation Award“ gestiftet hat. Alle Dokumente stehen unter CC. Daraus ist eine Drehscheibe für die Zivilgesellschaft geworden. Auch dieses innovative Format hat keine Fortsetzung erfahren.
Auch in Österreich haben zivilgesellschaftliche Initiativen maßgeblich zur Bildung gesellschaftlicher Medienkompetenz beigetragen. Darunter ist Quintessenz zu nennen, eine Gruppe von Aktivisten, Journalisten und Künstlern, die sich seit 1994 für Bürgerrechte im Informationszeitalter engagiert. Quintessenz veröffentlicht ein Blog und veranstaltet zudem die Big Brother Awards und die Linuxwochen. Der ehemalige AK Vorrat, heute Epicenter.Works, ist erfolgreich gegen das österreichische Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung vorgegangen und engagiert sich heute weiters für Netzneutralität und gegen Überwachungsgesetze. Schließlich ist der österreichische Jurist Max Schrems zu nennen, der erfolgreich gegen Facbooks Datenschutzverstöße vorgegangen ist, einen EuGH-Entscheid herbeiführte, der das „Safe Harbour”-Abkommen über den Datenexport aus der EU in die USA zu Fall brachte und die europäische Sammelklage erfand (zu Schrems s. unten unter „Public Open Space“).
ORF-Strukturumbau und Novellierung des ORF-Gesetzes
Derzeit befindet sich der ORF – wie BBC und ARD/ZDF – in einer turbulenten Phase. Ein Stabilitätsfaktor darin ist Alexander Wrabetz, den der ORF-Stiftungsrat im August 2016 zum dritten Mal in Folge zum Generaldirektor wählte (Horizont 09.08.2016). Im Dezember beschloss der Stiftungsrat eine Gebührenerhöhung um 6,5 Prozent ab Mai 2017. Im Gegenzug kündigte Wrabetz an, 330 Millionen Euro über die kommenden fünf Jahre einzusparen (Standard 15.12.2016).
Eine Novellierung des ORF-Gesetzes steht bevor. Für März, dann April war eine ORF-Enquete des Kanzleramts angekündigt worden (Standard 15.03.2017). Dabei geht es u. a. um die geplante Einführung eines ORF-Youtube-Kanals und die Ausweitung seiner bisherigen Social Media-Aktivitäten. Der Vorschlag befindet sich seit 03.02.2017 in der Auftragsvorprüfung, in der bis zum Ende der Konsultationsfrist Ende März drei Stellungnahmen eingegangen sind. Neben Beiträgen aus ORF-Sendungen sollen web-native Formate wie Webisodes gezeigt und Piloten ausgetestet werden. Vor allem soll eine mehrmals täglich aktualisierte Online-Nachrichtensendung im Umfang von unter drei Minuten produziert und über alle möglichen (insbesondere sozialen) Plattformen bereitgestellt werden. Da die derzeit bekannten Sozialen Medien keine technischen Mittel bereitstellten, mit denen eine Einschränkung der Behaltefristen möglich wäre, wird eine ‘typische Nutzung’ beantragt, die auch die dauerhafte Bereitstellung umfasst (z. B. Postings auf Facebook-Seiten). Dadurch erhöhe sich die Verknüpfbarkeit: „Als besonderer Vorteil eines ORF-YouTube Channels kann neben der horizontalen Strukturierung nach Themen und Genres auch die längerfristige Auffindbarkeit der ORF-Produktionen gelten; die Vielfalt des Angebots erhöht sich dadurch deutlich gegenüber dem durch die TVThek gegebenen Niveau.“ (Angebotskonzept Soziale Medien) Zudem plant der ORF, einen Standard-Kooperationsvertrag mit Google zu schließen und damit Werbung auf seine Inhalte schalten zu lassen. Da der ORF sparen und sich zu einem nicht unerheblichen Teil aus kommerziellen Einnahmen finanzieren muss, ist das ein willkommenes Zubrot, das auch die Gebührenzahler freuen sollte. Nicht so die Medienwirtschaft, allen voran den Verband Österreichischer Privatsender (VÖP). Der bezeichnete in seiner Stellungnahme den Vorschlag als gesetzwidrig und wettbewerbsverzerrend zum Schaden der Verbraucher. Der ORF wies die Kritik zurück.
Parameter des Bildungsauftrags im digitalen Zeitalter
Der Bildungsauftrag ist zentrales Element des Funktionsauftrages öffentlich-rechtlicher Medien. Private Medienanbieter unterstehen gleichfalls einem Bildungsauftrag, jedoch in geringerem Umfang (in Vollprogrammen, Fenstern von Drittanbietern in Vollprogrammen etc.) und mit deutlich geringerer Erwartung. Das deutsche Bundesverfassungsgericht unterscheidet hier regelmäßig zwischen den Eigenrationalitäten privater und öffentlich-rechtlicher Medien, die sich daraus ergeben, dass diese mit öffentlichen Mitteln einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen haben, während jene auf einen Profit am Markt zielen. Wenn die Gesellschaft eine kommerzfreie, sachgerechte mediale Bildung erwartet, kann sie dabei nur auf die staatlichen Bildungsträger und die öffentlich beauftragen Medien setzen.
Wie die bisherige Untersuchung gezeigt hat, reicht das Spektrum eines weit verstandenen Bildungsauftrags von unmittelbar auf Schule, Hochschule, Berufsaus- und Fortbildung bezogenen Angeboten über lehrreiche Kinder- und Jugendangebote bis zu allgemeineren Formen der Wissens- und Wissenschafts- und Kulturvermittlung und Beratung. Was diese Bestimmungen betrifft, hat sich der Funktionsauftrag öffentlich-rechtlicher Medien über die Zeit kaum verändert.
Was sich verändert hat, ist die medientechnologische Umwelt und die ihr angemessenen Formate, besonders einschneidend natürlich mit dem Übergang ins Internet. Der BBC ist von Beginn an aufgetragen, Medientechnologie aktiv zu entwickeln und entsprechend derer Verbreitung für ihren Auftrag zu nutzen. In Deutschland hat das BVerfG eine Entwicklungsgarantie kodifiziert, die sich stärker als Entwicklungsauftrag verstehen lässt, da die Öffentlich-Rechtlichen andernfalls ihren Funktionsauftrag nicht länger erfüllen könnten.
Im Internet ist alles anders, besonders das, was auf den ersten Blick ähnlich scheint. Internet ist kein Rundfunk. Jeder Knoten verfügt über eine Adresse, von der aus er sprechen und angesprochen werden kann. Im Netz treten Communities an die Stelle der Quote. Schon ein Basismedium wie Bewegtbild im Netz kann zu dem Missverständnis führen, es handele sich um Fernsehen in neuem Gewand. Bei Fernsehmachern herrscht der Eindruck vor, dass die meisten Inhalte auf Youtube von Nutzern, also Laien produziert werden. Aus der Ferne verkennen sie, dass sich Webvideo zu einem eigenständigen Medium entwickelt hat, das mit dem Fernsehen nichts zu tun hat.
Videoplattformen gab es auch schon in den 1990ern, aber erst mit der Gründung von Youtube 2005 und seiner Übernahme durch Google 2006 hat sich um Webvideos ein eigenes Ökosystem herausgebildet. Dazu gehört eine eigene Ästhetik und Ausdruckskultur, die sich in Genres ausdifferenziert hat für Wissens- und Wissenschaftsvermittlung (z. B. methodisch inkorrekt), politische Bildung (z. B. Bewegtbildung.net) und Kampagnen (z. B. YouGeHa, Youtuber gegen Hass), Beratung, Unterhaltung usw. (zu Youtube-Genres s. Rösch/Seitz 2013). Ähnlich wie der Grimme-Preis für Fernsehen prämiert das neue Medium Qualität mit dem Webvideopreis, den Videodays PlayAwards oder den Bobs – Best of Online Activism der Deutschen Welle. Als ökonomische Organisationsform haben sich verlagsartige Multi-Channel-Netzwerke herausgebildet. Die Anzugdichte auf dem seit 2010 jährlichen Branchentreffen Videodays hat deutlich zugenommen. Die Videodays sprengen inzwischen alle Hallen und fanden 2015 erstmals parallel mit 15.000 Teilnehmern in Köln und 6.000 in Berlin statt. Youtuber ist heute Traumberuf für viele Jugendliche.
Legt man den Maßstab des Fernsehens an, wird man bemerken, dass die meisten Webvideo-Macher keine Journalistenschulen, Studiengänge oder Volontariate bei Sendern durchlaufen haben, folglich als Laien erscheinen. Tatsächlich haben sie die „Schule“ von Youtube durchlaufen, das ein Autor des New Yorkers schon 2014 als „beinah erschreckend professionell“ bezeichnete (New Yorker 15.12.2014). Menschen, die über Jahre jede Woche mehrere Stunden Webvideo produzieren, regelmäßig ein Publikum von Hundertausenden oder Millionen erreichen und Zehntausend Euro pro Monat verdienen, als Laien zu bezeichnen, geht offenkundig an der Sache vorbei. Fernsehinhalte funktionieren in dieser Umgebung nicht. Hier müssen dem Medium und der Bildkultur angemessene Formate entwickelt werden.
Politische Bildung
Der zentrale Auftrag der ÖRM ist es, mit einem vielfältigen Angebot der individuellen und kollektiven Meinungsbildung zu dienen. Als Teil der ‘Vierten Gewalt’ erfüllen sie eine informationelle und kritische konstitutive Rolle in der Gewaltenteilung des demokratischen Staates. BürgerInnen können von ihren Wahl- und anderen Partizipationsrechten nur sinnvoll Gebrauch machen, wenn sie sich aus vielfältigen, öffentlich zugänglichen Quellen informiert und eine Meinung gebildet haben. Folglich ist zu erwarten, dass sich auch der Bildungsauftrag der ÖRM wesentlich auf die demokratiepolitische Bildung richtet (vgl. Naderhirn 2009). Um diese Meinungsvielfalt zu sichern, sind sie zur Berücksichtigung und Inklusion von Minderheiten verpflichtet, die für kommerzielle Medien keine profitablen Zielgruppen darstellen.
Politische Bildung wird in Deutschland oft mit der gleichnamigen Bundeszentrale in Verbindung gebracht. Diese wurde 1952 als Bundeszentrale für Heimatdienst gegründet, um im Rahmen der Reeducation einen Beitrag zur Erziehung der Deutschen zur Demokratie zu leisten und totalitären Bestrebungen entgegenwirken. Vor dem Hintergrund des wachsenden Ost-West-Konflikts (Korea-Krieg) sollte insbesondere der Kommunismus bekämpft werden. Die Aufarbeitung des Nationalsozialismus rückte erst in den 1960er Jahren ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatten. Ihren Auftrag erfüllte sie durch Studientage und andere Veranstaltungen sowie durch Publikationen (darunter bis heute: die Wochenzeitung Das Parlament, die Informationen zur politischen Bildung und Aus Politik und Zeitgeschichte). Als 1958 die erste Auflage des Grundgesetzes erschien, war es Aufgabe der Bundeszentrale, es zu verbreiten. Zudem fördert die Bundeszentrale bis heute Publikationen und Veranstaltungen Dritter und stellt audiovisuelle Medien für die politische Bildungsarbeit in Schulen und Institutionen bereit (bpb: Gründung und Aufbau 1952-1961). 1963 wurde sie in Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) umbenannt. Sie verstärkte die Zusammenarbeit mit den Landeszentralen für politische Bildung, die inzwischen in allen Bundesländern entstanden waren, und sie begann mit der Förderung von Forschung zur politischen Beteiligung (bpb: Etablierung und Ausbau 1961-1969).
Mit der Studentenbewegung den folgenden sozialen Bewegungen veränderte sich die politische Landschaft und damit die Aufgaben der politschen Bildung. Auf einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg im Jahr 1976 wurde der „Beutelsbacher Konsens“ formuliert, der bis heute in der politischen Bildung Gültigkeit hat. Er schreibt drei Prinzipien fest: Das Überwältigungsverbot (keine Indoktrination), das Gebot, kontrovers diskutierte Themen auch im Politik-Unterricht kontrovers darzustellen, sowie Schüler dahin gehend zu fördern, dass sie ihre eigenen Interessen analysieren und vertreten können (bpb: Wandel und Neuformierung 1969-1981). 1984 wurde das Referat „Neue Medien“ eingerichtet, das neben dem verstärkten Einsatz von Filmen ein didaktisches Konzept für Computer-Spiele und ein Bildschirmtext-Programm erarbeitete und 1997 die Website der bpb startete. Mit der deutschen Wiedervereinigung wurde es vorrangig, beiden Teilen der Bevölkerung gegenseitiges Wissen zu vermitteln, Lernprozesse anzustoßen und Verständnis zu erzeugen. 2001 formulierte ein Erlass des Bundesinnenministeriums die Aufgabe der Bundeszentrale neu. Sie hat nun „durch Maßnahmen der politischen Bildung Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken.“
Zusammen mit dem Beutelsbacher Konsens kann dies gleichermaßen zur Orientierung der Bildungsarbeit der öffentlich-rechtlichen Medien dienen. Doch wie geht – angesichts der einleitend aufgeführten Herausforderungen – politische Bildung im Netz? Die deutsche Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) hat angekündigt, bis Ende 2017 eine Strategie für die Handlungsfelder der allgemeinen und politischen Weiterbildung in der digitalen Welt als Teil des lebenslangen Lernens zu erarbeiten (KMK 2016: 10; 52).
Der Frage geht auch das Projekt Bewegtbildung.net nach. Anfang 2015 von der bpb und der Agentur für Medienbildung Mediale Pfade gegründet, etabliert es ein Netzwerk von Akteuren aus der politischen Bildung, der Medienpädagogik und dem Webvideo. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Webvideo, vor allem auf Youtube, eine wachsende Meinungsmacht unter jungen Publika darstellt, es dafür jedoch, im Unterschied zu der langen Erfahrung mit Film und Video in der Bildungsarbeit, zwar einiges an Praxis, aber noch keine fundierten Konzepte gibt. Auf Fachveranstaltungen und seiner Website bringt das Netzwerk die verschiedenen Akteure zusammen, um über bestehende Praktiken zu reflektieren, über neue Formate und Methoden der Bildungsarbeit im Netz nachzudenken und gemeinsame Bildungsprojekte mit Webvideo anzustoßen. Eines der Ergebnisse ist der Entwurf eines Katalogs von Kriterien für gelingende Bewegtbildung. Derzeit läuft eine Ausschreibung für Good-Practice-Beispiele für Projekte der webvideobasierten politischen und medienpädagogischen Bildung im Social Web, die in einem
“Atlas Bewegtbildung“ publizierte werden sollen. Geplant sind ferner eine Projektdatenbank und ein Inkubator für Projekte und Formate.
Erwachsenenbildung / Lebenslanges Lernen
Neben Angeboten für formelles Lernen auf Abschlüsse oder Zertifikate hin, geht es hier vor allem darum, informelles, selbst-motiviertes Lernen zu unterstützen. Im Internet bieten zahlreiche Spezialisten-Communities Neulingen Hilfe und Feedback. Die Bildungsforschung weiß, wie motivierend Auszeichnungen für erreichte Etappenziele sind.
Wie können diese Elemente vereint werden, um lebenslanges Lernen motivierend zu machen, fragte sich Peter Horrocks, Vize-Kanzler der Open University, in seinem Beitrag zu 100 ideas for the BBC. Seine Antwort: Die BBC könnte zusammen mit Online-Bildungsexperten wie der OU substantielle Sammlungen von Lehrmaterialien kuratieren. Die Mitglieder der darum entstehenden Community von Lernenden und Lehrenden können einander informell Feedback geben. Nach erfolgreichem Abschluss der Materialien, z. B. durch ein Quiz, erhielte der Lerner eine digitale Plakette, die er auf seinem LinkedIn- oder Facebook-Account präsentieren kann. Eine solche Anerkennen von Lernerfolgen über formelle Kursabschlüsse hinaus würde vorhandene Ressourcen umfassender nutzen und eine größere Zahl von ‘Freizeit-Lernern’ erreichen.
Integration
In unseren multikulturellen Gesellschaften ist Integration eine vorrangige gesellschaftliche Aufgabe. Die europäische Integration und die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an der Informationsgesellschaft gehört zu den ausdrücklichen Aufträgen öffentlich-rechtlicher Medien. Dass das Projekt einer europäischen Demokratie am Mangel einer europäischen Öffentlichkeit leidet, ist oft angemerkt worden. Die Lösung scheint in der Theorie ganz einfach, in der Praxis dagegen das genaue Gegenteil. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Barbara Thomaß, Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum und Mitglied im ZDF-Verwaltungsrat, entwickelte 2013 das Konzept eines kosmopolitischen, interkulturellen und trimedialen Cultures-TV, das viele wertvolle Ideen dazu enthält. Doch braucht es einen Europafunk, wie ihn Jakob von Weizsäcker und Andre Wilkens gefordert haben (Spiegel 10.12.2016), oder vielmehr ein dezentrales Modell, das die bestehenden Medien europäisiert und lokale Initiativen stärkt, wie Carl Henrik Fredriksson und Roman Léandre Schmidt in ihrer Replik argumentieren (Eurozine und Voxeurop, 07.04.2017)?
Funk.net umfasst bereits einige Formate, wie die politische Satire „Datteltäter“ und Tourettikette, die Vorurteile direkt und humorvoll angehen. Aber auch darüber hinaus verfügen die Funk-Formate über eine deutlich multikulturellere Besetzung als die Fernsehprogramme der beiden Anstalten.
Auch hier ist wieder auf zivilgesellschaftliche Initiativen zu verweisen. Z. B. die Silent University, eine Wissensplattform für Flüchtlinge und Migranten. Das Projekt ist in London gestartet, mit Niederlassungen in Stockholm und Hamburg. Es ermöglicht es Akademikern, die aufgrund ihres Status’ ihr Wissen nicht anderweitig einsetzen können, Lehre und Forschung zu organisieren. Zu den Partnern der Silent University gehört die No Border Academy. Aus der Webvideo-Szene ist die Kampagne #YouGeHa – YouTuber gegen Hass – entstanden, die sich gegen versteckten und offenen Fremdenhass und Ausgrenzung richtet. Auszeichnungen heben Leuchtturmprojekte hervor, hier vor allem der Civis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa.
Wissensvermittlung
Zur Wissensvermittlung können Spiele (serious games), Show- und fiktionale Formate eingesetzt werden. Vor allem ist damit aber der Dokumentarfilm angesprochen. Dessen Sendeplätze haben die Öffentlich-Rechtlichen immer mehr zusammengestrichen. Christian Beetz, Geschäftsführer der Gebrüder Beetz Filmproduktion und einer der renommiertesten Doku-Produzenten Deutschlands, beklagt, dass ARD und ZDF sich vom klassischen Dokumentarfilm nahezu verabschiedet hätten. Selbst bei Arte finde der Kinodokumentarfilm inzwischen nur noch auf Sendeplätzen in der Sommerpause statt. SVoD-Anbieter wie Netflix hingegen würden Dokumentarfilmer “geradezu hofieren”, sagt Beetz dem Medienmagazin der Deutschen Welle (DWDL 22.03.2017. Zum historischen Dokumentarfilm im deutschen Fernsehen s. Donaubauer 2011; zu politischen und zeitgeschichtlichen Dokumentationen im österreichischen Fernsehen s. Naderhirn 2009).
Medienkompetenz
Orientierung ist eine weitere Aufgabe öffentlich-rechtlicher Medien. Darunter werden neben Bildungs- vor allem Beratungsangebote verstanden. Dazu gehören Empfehlungen und Links, aber auch eine Kuratierung von externen Internet-Angeboten, wie es Kioski, das Online-Jugendangebot des finnischen Rundfunks macht und die BBC mit dem neuen Ideas-Service plant. In Zeiten von Fake News zählen dazu auch regelmäßig die Kontextualisierung und Faktenchecks zu externen Angeboten.
Der Begriff Orientierung geht in dem umfassenderen der Medienkompetenz auf. Für den Bildungsauftrag der ÖRM besonders im Internet ist es ausgeschlossen, die Vermittlung von technischer und inhaltlicher Medienkompetenz nicht zentral zu stellen.
In Deutschland ist die Förderung technischer und inhaltlicher Medienkompetenz aller Generationen und von Minderheiten durch Telemedienangebote ausdrücklich Teil des Auftrags (§ 11d, Abs 3 RF-StV). Doch schon mit der Einführung des dualen Systems Mitte der 1980er, das genau genommen ein triales ist, wurden mit dem Ziel der Vermittlung von Medienkompetenz die Offenen Kanäle eingeführt. Viele von ihnen existieren bis heute, andere haben sich zu Bürger- und Ausbildungskanälen gewandelt. Sie werden von den Landesmedienanstalten betrieben und sind mit dreißig Jahren Erfahrung naheliegende Partner für Medienkompetenzvorhaben.
Den Begriff „Medienkompetenz“ führte der Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke in den frühen 1970ern ein. Er setzte dabei einerseits auf Chomskys Konzept der linguistischen Kompetenz auf, andererseits auf einen an Habermas gebildeten Begriff der „kommunikativen Kompetenz“. Diese setze sich aus Sprachkompetenz und Handlungskompetenz zusammen (Baacke 1973: 262). Medienkompetenz nach Baacke ist ein Aspekt der umfassenderen kommunikativen Kompetenz. Er unterscheidet vier Dimensionen: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung.
Der Begriff ist in Bezug auf die klassischen Massenmedien entstanden. Seither sind weitere Konzepte hinzugetreten. So strebt man im Bibliotheksbereich eine Informationskompetenz an, die sich aus fünf Teilkompetenzen zusammensetzt: Suchen, Prüfen, Wissen, Darstellen und Weitergeben (Referenzrahmen Informationskompetenz). Auf informatische Kompetenzen geht der folgende Abschnitt ein.
In Deutschland hatte die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) im März 2012 eine Empfehlungen zur Medienbildung in der Schule vorgelegt. Ergänzend dazu beschloss sie im Dezember 2016 einen verbindlichen Rahmen für die Bildung in der digitalen Welt (KMK 2016). Darin richtet sich die KMK auch auf die berufliche Bildung und die Hochschulen, insbesondere die Lehrerbildung. Auch die allgemeine und politische Weiterbildung als Teil des lebenslangen Lernens sind eingeschlossen. Dafür hat die KMK bis Ende 2017 eigene Rahmenleitlinien angekündigt (ebd.: 10; 52).
Bekanntlich lernen wir nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Entsprechend definiert die KMK den Kern des Bildungs- und Erziehungsauftrags in der digitalen Welt darin, „Schülerinnen und Schüler angemessen auf das Leben in der derzeitigen und künftigen Gesellschaft vorzubereiten und sie zu einer aktiven und verantwortlichen Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen, politischen, beruflichen und wirtschaftlichen Leben zu befähigen.“ (Ebd.: 10)
In dem Strategiepapier verpflichten sich die Länder dazu, dafür Sorge zu tragen, dass alle Schüler, die zum Schuljahr 2018/2019 in die Grundschule oder in die Sekundarstufe I eintreten, bis zum Ende ihrer Pflichtschulzeit die in diesem Rahmen formulierten Kompetenzen erwerben können. Bis 2021 soll jeder Schüler jederzeit einen Zugang zum Internet und eine digitale Lernumgebung nutzen können.
Die digitale Medienbildung soll bereits in der Primarstufe beginnen. Sie soll nicht als eigenes Fach, wie etwa Informatikunterricht, umgesetzt werden, sondern als integraler Teil der Fachcurricula aller Fächer. „Jedes Fach beinhaltet spezifische Zugänge zu den Kompetenzen in der digitalen Welt durch seine Sach- und Handlungszugänge. Damit werden spezifische Fach-Kompetenzen erworben, aber auch grundlegende (fach-) spezifische Ausprägungen der Kompetenzen für die digitale Welt.“ (KMK 2016: 11 f.)
Das Strategiepapier gibt keine konkreten Ziele oder gar Software-Produkte vor, die erlernt werden sollen, sondern formuliert spezifische Kompetenzen. Dabei stützt es sich auf drei bewährte Modelle: das von der EU-Kommission in Auftrag gegebene und vom Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) entwickelte Kompetenzmodell „DigComp“, das „Kompetenzorientierte Konzept für die schulische Medienbildung“ der Länderkonferenz Medienbildung vom 29.01.2015 und das Modell der „computer- und informationsbezogenen Kompetenzen“, das der empirischen ICILS-Studie von 2013 „Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in der 8. Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich“ zugrunde liegt.
Die KMK gliedert ihre daraus gewonnen Anforderungen in sechs Kompetenzbereiche:
1. Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren
2. Kommunizieren und Kooperieren
3. Produzieren und Präsentieren
4. Schützen und sicher Agieren
5. Problemlösen und Handeln
6. Analysieren und Reflektieren (ebd.: 15 ff.)
Unter den Voraussetzungen für die Umsetzung ihrer Strategie sieht die KMK die Ausstattung der Schulen mit einer Infrastruktur aus Breitband, WLAN, mobilen Endgeräten, Lernplattformen (wie Moodle) und Mediatheken, die Klärung verschiedener rechtlicher Fragen (u. a. Lehr- und Lernmittel, Datenschutz, Urheberrecht), die Weiterentwicklung des Unterrichts und vor allem auch eine entsprechende Qualifikation der Lehrkräfte. Auch die Vorgaben für Medienpässen oder Computerführerscheine müssen angepasst werden.
Mit „Mediatheken“ sind strukturierte Sammlungen von Materialien und Best-Practice-Beispielen gemeint, die den Lehrenden, Auszubildenden und Lehrkräften nach Fächern und Schularten gegliedert angeboten werden sollen (ebd.: 28). Neben originären Bildungsmedien von Schulbuchverlagen, Produzenten von Bildungssoftware, öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, Landesmedienanstalten u. a. verweist die KMK hier auch auf die Mediensammlungen von Museen, Archiven und Bibliotheken – wie z. B. in der Deutschen Digitalen Bibliothek oder in den Europeana Collections sowie auf das ländereigene Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU), die Landesmedienzentren und den Deutschen Bildungsserver (ebd. 30 ff.).
Zu Open Educational Resources (OER), Bildungsmaterialien unter eine Freilizenz, die Veränderung und Weiterverbreitung erlaubt, äußert sich die KMK zögerlich. Digitale Bildungsmedien seien flexibel, modularisierbar, interaktiv und vernetzt. Die bisherigen nationalen und internationalen Diskussionen und praktischen Erfahrungen in verschiedenen Staaten legten nahe, „dass auch offene Bildungsmaterialien über diese Potentiale verfügen“ (ebd. 31). Weiter heißt es, OER hätten bereits eine sehr große Verbreitung und ließen sich flexibel in die Lehre einbetten. Aber: „Entwicklung und Einsatz sind vielfach noch von einer Rechtsunsicherheit behaftet. Da es bislang keine Geschäftsmodelle zur Refinanzierung gibt, ist eine Weiterentwicklung mit Mehrkosten verbunden. Erforderlich sind daher die Schaffung eines klaren und transparenten Rechtsrahmens sowie Mittel für die Grundversorgung und für Leuchtturmprojekte“ (ebd. 47). Worin diese Rechtsunsicherheit bei der Verwendung einer Creative Commons oder anderen etablierten Freilizenz besteht, wird nicht erläutert. Das bemängelt auch das Bündnis Freie Bildung in seiner Stellungnahme zur KMK-Strategie (31.01.2017). Das Bündnis lobt die KMK für ihre Zusammenarbeit mit den OER-Initiativen, bedauert aber überdies, dass die KMK Freie Software und Hardware mit keinem Wort erwähnt. Immerhin kündigte die KMK an, ein zentrales Büro zur Förderung von OER schaffen zu wollen, das über Potentiale von OER aufklären, bestehende Aktivitäten vernetzen und Kooperationen anregen soll (KMK 2016: 32). Dazu ist die 2012 von dem Pädagogen Jöran Muuß-Merholz gegründete „Transferstelle für OER“ im November 2016 in die neue Informationsstelle OER OERinfo unter Trägerschaft des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) überführt worden.
Informatische Kompetenzen bleiben im KMK-Rahmen für Digitalbildung auffällig unterbelichtet. Computerkompetenz wird nur im Zusammenhang mit dem Europäischen Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen des Lebenslangen Lernens (2006) erwähnt (KMK 2016: 45). Die angestrebten Kompetenzen gingen „über notwendige informatische Grundkenntnisse weit hinaus“ (ebd.: 12). Das Papier nimmt sich zur Aufgabe, die Anforderungen für eine schulische Bildung in der digitalen Welt zu präzisieren und zu erweitern, und fügt hinzu: „Gleiches gilt für bewährte Konzepte informatischer Bildung.“ (ebd.: 11) Die tauchen aber im Folgenden nicht mehr auf. Programmierfähigkeit wird gar nicht genannt. Wohl findet sich unter den angestrebten Kompetenzen: „eine Vielzahl von digitalen Werkzeugen kennen und kreativ anwenden“, „algorithmische Strukturen in genutzten digitalen Tools erkennen und formulieren“ und „eine strukturierte, algorithmische Sequenz zur Lösung eines Problems planen und verwenden“.
Die Anforderungen, die hier im pädagogischen Zusammenhang formuliert werden, sind auch für den Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Medien relevant, unmittelbar, wo er sich auf schulische, berufsbildende und hochschulische Curricula bezieht, aber auch dort, wo er eine breite digitale Kompetenz fördern soll. Neben den Anstalten selbst betreiben und fördern auch die Landesmedienanstalten Projekte zu Medienkompetenz und Medienbildung (hier z. B. die Medienanstalt Berlin-Brandenburg).
Im März 2016 hatte der Mitteldeutschen Rundfunk angekündigt, in Erfurt ein neues Medienkompetenzzentrum aufzubauen. Sein Ziel soll es sein, Zuschauer, Hörer und Nutzer zu einem bewussten Umgang mit Medien zu ermutigt und zu befähigen. Dazu sollen Anzahl und Vielfalt von Medienkompetenzthemen in allen MDR-Angeboten spürbar gesteigert werden, erläuterte MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende Karola Wille damals dem Medienrat. Für die kritische und selbstkritische Auseinandersetzung mit Medien war ursprünglich auch ein Medienkompetenz-Magazin im MDR-Fernsehen und -Hörfunk geplant. Im Februar 2007 ging das Zentrum mit der Site Medien360G an den Start.
Die kleine Redaktion mit zwei festen und sechs freien Mitarbeitern und einem schmalen Budget will vor allem versammeln und vernetzen, was es an Angeboten schon gibt, aber auch den Redaktionen zuarbeiten. Ein erstes Beispiel war der Thementag von MDR Aktuell zu Fake News, der am 7. Februar mit guter Resonanz lief. Die Pläne für eigene TV- und Radioprogramme sind gegenüber Online inzwischen in den Hintergrund getreten. Um heraus zu bekommen, wo es Defizite und Bedarfe in der Medienkompetenz gibt, arbeitet die Redaktion außerdem mit Forschern an der Uni Leipzig, der TU Ilmenau, der TH und FH Erfurt zusammen (MMM 27.02.2017).
Informatische Kompetenz
Neben der klassischen audiovisuellen Medienkompetenz ist im Universalmedium des vernetzten Computers informatische Bildung unerlässlich. Dabei geht es neben dem Wohl der Kinder auch um das der Gesellschaft. In allen drei Ländern wird ein Fachkräftemangel in den MINT-Feldern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) attestiert. Hatte das Institut der deutschen Wirtschaft in seinem MINT-Frühjahrsreport 2015 noch eine Arbeitskräftelücke von 137.100 Personen vermeldet, so erreichte diese im August 2017 mit 274.600 einen neuen Höchststand (IW 12.09.2017). Das Signal scheint jedoch angekommen zu sein. Die OECD-Bildungsindikatoren 2017 zeigen den Anteil der MINT-Fächer unter den Hochschulabschlüssen. Mit rund 35% lag Deutschland 2016 an der Spitze aller OECD-Länder (OECD 2017: 49).
Auch für eine Berufsausbildung bringen deutsche Schulabgänger nicht die notwendigen digital-medialen Voraussetzungen mit, wie ein Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigte. Der Bericht schließt mit Empfehlungen für die Medienkompetenzbildung an allgemeinbildenden Schulen, in Unternehmen und in Berufsschulen (Krämer, Jordanski, Goert 2017).
In UK ist Programmieren seit September 2014 Pflichtfach für Grund- und Mittelschüler. Die BBC unterstützt das Anliegen mit Bildungsmaterialien und Kooperationen wie die mit Doteveryone.
Auch in Deutschland ist Informatik in vielen Bundesländern bereits als Schulfach eingeführt worden, doch Herangehen und Qualität unterscheiden sich sehr (Starruß 2017). Noch streiten die Experten, ob Programmieren auf den Lehrplan gehört oder das Ziel eine „digitale Kompetenz“ als Querschnittsaufgabe in allen Fächern seien müsse (z. B. Heise Technology Review, 23.03.2017).
Die deutsche Gesellschaft für Informatik hatte in ihrem Arbeitskreises „Bildungsstandards“ seit dem Herbst 2003 Empfehlungen für Informatik in der Sekundarstufe I erarbeitet und diese als
Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule im Januar 2008 vorgelegt. Diese wurden im Februar 2016 durch die Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt ergänzt. Dazu hatten sich Experten aus der Informatik und ihrer Didaktik, der Medienpädagogik, der Wirtschaft und der Schulpraxis in einem eher seltenen interdisziplinären Gespräch zusammen gefunden. Ihre Grundthese ist, dass Bildung in der digitalen vernetzten Welt aus technologischer, gesellschaftlich-kultureller und anwendungsbezogener Perspektive in den Blick genommen werden müsse, eine Trias, die als „Dagstuhl-Dreieck“ in die Diskussion eingegangen ist (s. Videoerklärung). Es müsse einen eigenständigen Lernbereich für die Aneignung der grundlegenden informatischen Konzepte und Kompetenzen geben. Daneben sei es Aufgabe aller Fächer, fachliche Bezüge zur digitalen Bildung zu integrieren. Sie müsse kontinuierlich über alle Schulstufen und für alle Schüler angeboten werden und erfordere natürlich eine entsprechend fundierte Lehrerbildung. Das sei jedoch noch Zukunftsmusik. „Bis diese Forderungen umgesetzt sind, bedarf es kurzfristiger Maßnahmen, die direkt die Schüler_innen und Lehrer_innen adressieren, z. B. unter Einbezug außerschulischer Lernorte und externer Expert_innen und Bildungspartner.“ (GI 2016)
In der Tat sind es bislang vor allem zivilgesellschaftliche Initiativen, die die Vermittlung von Informatikkompetenz organisieren, wie der Chaos Computer Club mit der Initiative Chaos macht Schule oder Jugend hackt und Code for Germany, beide getragen von der Open Knowledge Foundation.
Dazu gehört auch das Calliope-Projekt, das dem Beispiel des BBC micro:bit folgt und einen Kleinstcomputer entwickelt hat, mit dem sich in der Grundschule erste Schritte in Elektronik und Programmierung unternehmen lassen. Ziel ist es, jedem Schulkind in Deutschland ab der dritten Klasse einen spielerischen Zugang zur digitalen Welt zu ermöglichen. Der Calliope mini wurde im Januar 2017 kostenlos in allen dritten Klassen des Saarlands und an ersten Pilotschulen in Bremen verteilt. Alle Materialien, Hardware, Software und begleitende Lehrmaterialien, darunter auch solche des Schulbuchverlages Cornelsen, werden unter der OER-freundlichen BY-SA CC-Lizenz veröffentlicht. Das Projekt wird von einer gemeinnützigen GmbH getragen. Es hat eine Anschubfinanzierung durch das Bundeswirtschaftministerium erhalten, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne durchgeführt und Sponsoren eingeworben.
Schulungen und Weiterbildung in den Anstalten
Vor den Schülern müssen die Lehrer gebildet werden. Die Entwicklungsgarantien für die Institutionen übersetzen sich in die Aufgabe, die Mitarbeiterinnen mitzunehmen und niemanden zurück zu lassen. Um über den Medienwandel aufzuklären, muss man ihn vollziehen und verstehen, ob in den Schulen oder in öffentlich-rechtlichen Medien.
Neben internen Schulungen und Weiterbildungen haben sich hier vor allem Strategien der Öffnung und des Dialogs bewehrt: Workshops mit jungen Talenten, Hacklabs, Ideenwettbewerbe und Start-up-Förderungen tragen dazu bei, jüngere Zielgruppen und mögliche Partner anzusprechen, aber auch dazu, Innovationen in die Anstalten zu tragen und Erneuerung und einen digitalen Kulturwandel unter den MitarbeiterInnen zu bewirken.
Urheberrecht
Das Urheberrecht spielt eine zentrale Rolle bei der Frage, wie (Rundfunk-) Inhalte on- und offline genutzt werden dürfen, in welchem zeitlichen und räumlichen Umfang und ob DRM (z. B. im BBC iPlayer), Geoblocking oder Upload-Filter (Youtubes Content ID und seine Folgen) eingesetzt werden. Genauer: nicht das Urheberrechtsgesetz selbst, das dem Urheber im Wesentliche die volle Verfügung über sein Werk sichert, sondern dessen vertragliche Ausgestaltung zwischen Urheber, Verwerter und Nutzer.
Der Urheber selbst kann mit Hilfe von Freilizenzen aller Welt Nutzungen wie Kopieren, Weiterverbreiten und Verändern erlauben. Auf sie wird im folgen Abschnitt zu Archiven eingegangen. Aber auch der Gesetzgeber hat die exklusiven Rechte der Urheber beschränkt, im Interesse aller (in Form der Privatkopie) oder bestimmter Gruppen, darunter auch Bildung und Wissenschaft.
In der aktuellen Novellierung des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland steht diese Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Zentrum. Sie soll an die aktuellen Erfordernisse der digitalen Wissensgesellschaft angepasste werden, also die Regeln klären, nach denen Lehrer, Wissenschaftler und Forscher Teile geschützter Werke nutzen und vervielfältigen dürfen, und Bibliotheken, Museen und Archive Rechtssicherheit für ihre Arbeit geben. Das wird u. a. vom Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ seit Jahren gefordert.
Der Regierungsentwurf, der am 12.04.2017 vorgelegt wurde, löste Enttäuschung aus. Lehrer und Forscher sollen demnach aufgrund von Verlegerprotesten statt 25 Prozent, wie es der Referentenentwurf vorgesehen hatte, nur 15 Prozent eines Werks kopieren und in elektronische Semesterapparate einstellen dürfen. Diese Nutzung ist vergütungspflichtig, d. h. über die Verwertungsgesellschaften fließen Autoren und Verlagen Zahlungen zu. Bibliotheken sollen künftig Kopien herstellen und diese im Zusammenhang mit Restaurierungen auch verbreiten und verleihen dürfen. An Leseterminals in ihren Räumen sollen sie Nutzern je Sitzung bis zu 10 Prozent eines Werks für nicht-kommerzielle Zwecke verfügbar machen dürfen. Im selben Umfang soll ihnen erlaubt werden, auf Einzelbestellung hin Kopien zu versenden. Beide Nutzungen, Leseterminals und Fernleihe, sollen die Verlage jedoch in vertragliche Vereinbarungen ausschließen dürfen.
Text- und Data-Mining bezeichnet Verfahren, um großen Dokumentenmengen automatisiert auszuwerten und daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen. Für die erforderlichen Vervielfältigungen ist bislang eine Erlaubnis für jedes einzelne Dokument erforderlich. Hier greift der Entwurf Plänen für eine Änderung des europäischen Urheberrechts vor. Anders als diese begrenzt der deutsche Entwurf die Mining-Schranke jedoch auf nichtkommerzielle Zwecke. Der Deutschen Nationalbibliothek soll weiters per Web-Harvesting erlaubt werden, frei zugängliche Internetinhalte zu archivieren (Heise 13.04.2017). Wie ein Textvergleich von Referenten- und Regierungsentwurf zeigt, hatte das massive Lobbying der Verlage Erfolg.
Am 30.06.2017 beschloss der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (UrhWissG). Der Bundesrat erhob keine Einwände. Am 07.09.2017 wurde das UrhWissG im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Am 1. März 2018 wird es in Kraft treten.
Von dem Wunsch Puttnams, audiovisuelle Medien wie Bücher in öffentlichen Bibliotheken und auch übers Netz bereitzustellen (Puttnam 2006), sind wir also noch weit entfernt. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung erfolgte jedoch in Portugal. Dort wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Umgehung von Kopierschutztechnologien (DRM) für Wissenschaft, Bildung und Privatkopie erlaubt (Netzpolitik 11.04.2017).
Bei der aktuellen Reform des europäischen Urheberrechts drohen weitere Einschränkungen, die auch für ÖRM relevant sind.
Der Kommissionsentwurf vom 14.09.2016 sieht vor, dass Sites, auf denen Nutzer Inhalte hochladen können, Upload-Filter nach Art von Youtubes Content-ID einrichten sollen, die verhindern, dass geschützte Werke zugänglich werden (Art. 13). Auch das neue Leistungsschutzrecht für Presseverlage, das zwar in der Praxis in Deutschland und Spanien bereits gescheitert war, hält sich hartnäckig, nachdem der vormalige Digitalkommissar Günther Oettinger darauf gedrängt hatte (Art. 11). Die vorgesehene Text- und Datamining-Schranke ist begrenzt auf Forschungsorganisationen und auf Werke, zu denen diese rechtmäßig Zugang haben (Art. 3). Zu der einhellig negativen Reaktion von Experten auf den Entwuf, s. die ursprüngliche Rapporteurin Julia Reda.
Für ÖRM ist Urheberrecht tägliches Brot beim Rechteerwerb, der Auftragsvergabe und Nutzung. Daher sollten sie sich im eigenen Interesse auch bei der Änderung des Urheberrechts engagieren. Durch ihren Bildungsauftrag sind sie direkt von der aktuellen Debatte über die Bildungs- und Wissenschaftsschranke betroffen. Auch die Regelungen zu Archiven werden sie betreffen – wenn sie denn endlich einen Archivauftrag erteilt bekommen. Schließlich regelt das Urheberrecht in ungleich größerem Maße als im analogen Zeitalter auch die Werknutzung von Privatpersonen. Daher sind Urheberrechtskenntnisse wichtiges Element der von ÖRM zu vermittelnden Medienkompetenz.
Archivauftrag und CC-Lizenzierung
Die Bereitstellung eines öffentlichen Archivs ist eine konsistent von fast allen Akteuren geteilte Erwartung an die Öffentlich-Rechtlichen. Die Studie Public Network Value der Universität Salzburg im Auftrag von ORF und BR ergab, dass den Experten zufolge, gleich nach dem leichten Zugang zu den Angeboten, an zweiter Stelle die Bereitstellung eines umfangreichen Wissensarchivs von Bedeutung ist.7
Die derzeitigen Verweildauerbeschränkungen stoßen durch ihre willkürliche Verkürzung des Archivs von laufenden politischen, sozialen, kulturellen Debatten auf breites Unverständnis. Für die BBC ist die ‘Catch-up’-Frist von anfangs 7 auf 30 Tage verlängert worden. In Deutschland befassen sich alle aktuellen Drei-Stufen-Tests mit der Verlängerung der Verweildauern. Das finnische YLE verspricht, die Konzertaufnahmen seines Rundfunk-Orchsters bis 2100 online zu halten.
Die U30 nutzen Medien on Demand. Umso wichtiger ist es, dass es eine Gesamtschau auf die aktuell verfügbaren öffentlich-rechtlichen Inhalte gibt, damit die Nutzer finden können, was angeboten wird. Browsing, das Durchstöbern eines Katalogs nach interessanten Entdeckungen, ist eine grundlegende Kulturtechnik, nicht erst seit dem Netz. Die größte Annäherung daran bietet der BBC iPlayer. In Deutschland muss man bislang die Mediathek jeder einzelnen Rundfunkanstalt durchsuchen.
Dieses Desiderat ist seit 2008 beantwortet worden. Selbst mit den verschiedenen Verweildauern halten die deutschsprachigen Öffentlich-Rechtlichen einschließlich Österreich und Schweiz in ihren Mediatheken zu jeder Zeit fast 200.000 Beiträge vor. Xaver_w entwickelte MediathekView, das einen Index dieses Bestandes erstellt und erlaubt, ihn zu durchsuchen und die Beiträge zu streamen oder herunterzuladen. Das Freie Software Projekt bot zunächst einen lokalen Java-Client. Ende 2016 übernahm ein neues Team das Projekt und stellt MediathekView nun auch im Browser zur Verfügung. Für die Förderung einer europäischen Öffentlichkeit wäre es ideal, über ein ähnliches Interface auf sämtliche öffentlich-rechtlichen Online-Angebote in der EBU zugreifen zu können.
Zuallererst gilt es, das audiovisuelle kulturelle Erbe in den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Archiven zu digitalisieren, um es für kommende Generationen vor dem Verfall zu bewahren. Die Retrodigitalisierung in UK läuft. In den Niederlanden ist sie bereits abgeschlossen (s. das Medienarchiv Beeld en Geluid). Die aktuellen Sendungen werden in UK seit 2007 mit Hilfe von BBC Redux automatisiert aufgezeichnet. In Deutschland und in Österreich werden natürlich ebenfalls die presserechtlich vorgeschrieben Speicherungen vorgenommen, aber nicht über die Fristen hinaus archiviert. Eine systematische Archivierung findet nicht statt. Dazu fehlt bislang der Auftrag. Prof. Dr. Bernt Hugenholtz, Direktor des Instituts für Informationsrecht (IViR) der Universität Amsterdam, forderte folglich, dass der Grundversorgungsauftrag um ein öffentliches Mandat zur Bewahrung und Nutzbarmachung des medialen Kulturerbes ergänzt werden müsse.
Wie das, was archiviert wird, auch zugänglich und nutzbar gemacht werden kann, ist eine noch viel schwierigere Frage. Hier sehen sich die öffentlich-rechtlichen Medien einer Vielzahl von Inhabern von Urheberrechten gegenüber, von Musikern, kleinen und mittleren Produktionsfirmen aber auch Industriegrößen wie Time Warner, Disney oder Sony und mächtigen Verwertungsgesellschaften wie der GEMA. Sie waren es, die die BBC dazu bewog, ihren iPlayer mit DRM auszustatten. Daher sind kreative Weiternutzungen bislang meist nur in geschützten Räumen möglich, ggf. mit einer Rechteklärung, bevor Laborexperimente veröffentlicht werden.
Um jungen Medienmacherinnen einen Fundus an Bewegtbild zur Weiternutzung verfügbar zu machen, reicht es nicht aus, im Einzelfall die Rechte zu klären. In der Netzkultur sind pauschale Freilizenzen das Signal, dass kreative Weiternutzung erwünscht ist, Lizenzen, die die Modifikation und Verbreitung der abgeleiteten Werke erlauben. Die BBC Creative Archive Initiative ging daher in die richtige Richtung, doch hat sie bislang keine Folgen gezeitigt.
In Deutschland hat sich eine ARD-Arbeitsgruppe mit der Frage beschäftigt und 2014 die Verwendung von Creative Commons-Lizenzen empfohlen. Sie weist darauf hin, dass eine Beschränkung der Freilizenz auf nichtkommerzielle Nutzung (NC) dazu führt, dass diese Inhalte u. a. nicht in der Wikipedia genutzt werden können. (Zu den Folgen der CC-NC-Lizenz s. Paul Klimpel, Freies Wissen dank Creative-Commons-Lizenzen. Folgen, Risiken und Nebenwirkungen der Bedingung „nicht-kommerziell – NC“, Mai 2012). Einige Präzedenzfälle gibt es inzwischen. Der Elektrische Reporter (ZDF) wird vollständig und Quer (BR) in Ausschnitten unter CC BY-NC-SA veröffentlicht. Space Night (BR) und Breitband (DRadio Kultur) verwenden CC-Musik und geben eigenen Kompilationen heraus.
Datenschutz
In den terrestrischen Rundfunk war anonyme Nutzung und damit Datenschutz gewissermaßen eingebaut. Spätestens mit dem Schritt ins Internet betrifft die ÖRM dieses Thema nun unmittelbar. Hier lösen Nutzer mit jeder Aktion Datenströme aus. Während es für die Betriebssysteme von PCs und Laptops Werkzeuge gibt, um persönliche Daten zu schützen, ist das bei mobilen Geräten schwieriger, bei denen zudem sensible Bewegungsdaten anfallen. Noch problematischer sind Smart-TVs. HbbTV wird spöttisch als das „Guckloch der Sender“ bezeichnet. Wenn diese Geräte sich über Sprachbefehle steuern lassen oder Haushaltsmitglieder mit Hilfe von Gesichtserkennung unterscheiden – vermeintlich, um ihnen individuelle Dienste zu bieten – empfehlen Sicherheitsexperten: Kameras und Mikrofone abkleben (FAZ 17.06.2015).
Was Arte und BR auf innovative Weise mit „Do not track“ thematisieren, müssen die ÖRM selbst in ihrem Handeln im Ökosystem Internet vorbildhaft vorleben. Dazu gehört, dass Nutzungsmessung nur nach strengem europäischem Recht und ausschließlich auf Servern im Schengen-Raum erfolgt.
Die Personalisierung ihrer Online-Angebote wird derzeit von den ÖRM in allen drei betrachteten Ländern angestrebt. Doch gerade weil „alle“ das machen – also genau die kommerziellen Plattformen, deren Monopolmacht und Bindungskraft die ÖRM bedrohen und die Personalisierung vorrangig für Werbung einsetzen – dürfen die Öffentlich-Rechtlichen dem Trend nicht einfach hinterher rennen. Ihre besondere Verantwortung gebietet es, nach Alternativen zu suchen. Tatsächlich geht Attraktivität und Relevanz auch ohne Personalisierung, wie Funk.net beweist. In der Datenschutzerklärung des Jugendangebots heißt es, dass die Site keine personenbezogenen Daten speichert und keine Tracking-Programme einsetzt, die das Webverhalten der Nutzer protokollieren. Anonymität wird zugesichert. Protokolldaten werden intern ausgewertet, aber nicht an Dritte weitergegeben. Statistische Daten schließlich werden anonymisiert auf Servern in Deutschland gespeichert und vom französischen Unternehmen AT Internet und der deutschen INFOnline GmbH analysiert. Auf der Website können keine Accounts angelegt werden. Auch die App benötigt kein Login, um sich die „Keeps“ und „Kicks“ einzelner Formate zu merken, die bislang einzige Form expliziten Feedbacks in der App.
Das Tracking-Unwesen europäischer Medien-Sites hat sich nach Snowden etwas verbessert, wie man auf Trackography verfolgen konnte. Dieses Angebot der Initiative Tactical Tech zeigt an, welche unbeabsichtigten Datenströme man auslöst, wenn man die Seiten von Medien-Sites aufruft. Allerdings schicken bbc.co.uk und bbc.com, heute.de und tagesschau.de auch heute noch Daten zur Analyse in die USA, orf.at hingegen nicht. Auch hier geht Funk.net den richtigen Weg, indem es nicht einfach das macht, was „alle“ machen.
Öffentlich-Rechtliche im digitalen Ökosystem
Wenn sich die Öffentlich-Rechtlichen ins Internet begeben, werden sie Teil des Ökosystems. Daher müssen sie nicht nur darüber berichten und Aufklärung und Medienkompetenz schaffen, sondern auch mit gutem Beispiel vorangehen. Als Akteure sind sie darüber hinaus gehalten, im eigenen Interesse wie in dem ihrer Nutzer in den laufenden netzpolitischen Debatten zu intervenieren.
Vorratsdatenspeicherung
Die massenhafte, verdachtslose Speicherung von Kommunikationsdaten ist mit Grundrechten nicht vereinbar und schreckt weder von Straftaten ab, noch erhöht sie den Anteil der aufgeklärten Straftaten. So lässt sich die anhaltende Auseinandersetzung um die EU-
Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten (2006/24/EG) aus dem Jahr 2006 zusammenfassen. In den folgenden Jahren setzten Deutschland, Österreich und Britannien wie die anderen EU-Mitgliedsländer die Richtlinie in nationales Recht um. In Deutschland wurden gegen das Gesetz mehrere Verfassungsbeschwerden eingelegt, darunter eine Sammelbeschwerde von 34.939 Personen organisiert durch den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Das Bundesverfassungsgericht schränkte zunächst per einstweiliger Anordnung das Vorratsdatenspeicherungsgesetz stark ein und erklärte es in seinem Urteil vom März 2010 für verfassungswidrig. Auch in Österreich gingen Klagen beim Verfassungsgerichtshof ein, da das Vorratsdatengesetz die österreichische Bundesverfassung und die EU-Grundrechtecharta verletze. Der VfGH beschloss im November 2012 die Frage dem EuGH vorzulegen. Aufgrund dieses Antrags des VfGH entschied der EuGH im April 2014, die Vorratsdaten-Richtlinie wegen Verstoßes gegen das in der Europäischen Grundrechtecharta normierte Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, des Grundrechts auf Schutz der personenbezogenen Daten und wegen Verstoßes gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit als ungültig aufzuheben.
Daraufhin unternahm Britannien mit dem Data Retention and Investigatory Powers Act vom Juli 2014 einen weiteren Anlauf. Der deutsche Bundestag verabschiedete Ende 2015 ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, dem eine noch größere Zahl von Verfassungsbeschwerden folgte als gegen das Gesetz von 2007. Internet-Serviceprovider, die ab dem 1. Juli 2017 zur Speicherung verpflichtet waren, stellten dagegen einen Eilantrag bei einem Verwaltungsgericht, dem das Oberverwaltungsgericht statt gab. Schließlich setzte die Bundesnetzagentur die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren aus (Golem 28.06.2017).
Von den Gefahren der Vorratsdatenspeicherung sind alle Bürger betroffen, aber noch einmal besonders Berufsgeheimnisträger wie Ärzte, Anwälte und Journalisten. Im Zuge des deutschen Gesetzgebungsverfahrens von 2015 schlossen sich ARD, ZDF, Journalistenverbände und – in seltener Eintracht – auch die Verbände von Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern und Privatfunk zu einer Stellungnahme (07.09.2015) zusammen. Darin schrieben sie, die vorgeschlagene Vorratsdatenspeicherung sei „weder verfassungsrechtlich noch europarechtlich zu rechtfertigen“. Sie stelle „einen massiven Eingriff in die Bürgerrechte“ dar und sei mit dem journalistischen Berufsgeheimnis nicht vereinbar.
Netzneutralität
„Das umfassendste Angebot nützt nichts, wenn es nicht zum Adressaten gelangt. Daher ist Netzneutralität eine Grundvoraussetzung für die Sicherung von inhaltlicher und kultureller Vielfalt sowie für die Gewährleistung eines freien Zugangs zu meinungsbildenden audiovisuellen Inhalten im Internet,“ schreibt die ARD in ihrem Papier zu Auftrag und Struktur in Zeiten digitaler Medien im November 2016. „Netzneutralität ist eben nicht nur ein bundesrechtliches Telekommunikationsthema, sondern ein rundfunkrechtliches Vielfaltsthema.“ (ARD 2016b: 22)
Die ARD befürchtet die Wiederkehr der Entgelte, die die Kabelnetzbetreiber für die Einspeisung von Rundfunkprogrammen in ihre Netze verlangt haben und von denen sich die ARD erst Ende 2012 als letzter europäischer Öffentlich-Rechtlicher durch fristgerechte Vertragskündigung befreit hatte. Nun drohen Einspeisegebühren ins Internet.
Extrakosten für Anbieter, um schneller oder gar überhaupt zum Nutzer zu kommen, sind einer der Verstöße gegen die Netzneutralität, die die EU mit ihrer Verordnung vom November 2015 ausschließen will. Genauso problematisch sind für den Nutzer kostenlose Angebote. Mit Zero-Rating sind Angebote von Partnern des Netzbetreibers, z. B. Streaming-Dienste, gemeint, deren Nutzung dieser nicht auf den Volumentrarif des Kunden anrechnet. Facebook-Zero, Google Free Zone und leider auch Wikipedia-Zero waren unrühmlichen Beispiele dafür.
Im April 2017 stellte die Telekom mit StreamOn ein neues Zero-Rating-Angebot vor: „Unterwegs Musik und Videos streamen ohne Verbrauch Ihres Datenvolumens“. Die Telekom argumentiert, dass ihr Dienst allen Streaminganbietern diskriminierungsfrei offen stehe (Netzpolitik 11.04.2017). Auch das ZDF meldete auf Twitter: Da StreamOn sämtlichen Anbietern audiovisueller Angebote kostenfreie Berücksichtigung ermögliche, erkenne man keine Diskriminierung. Dazu liegen jedoch gegenteilige Erfahrungen vor. So wurde der Podcast-Plattform bitlove.org die Aufnahme verweigert, da sie nicht nur Streaming, sondern auch Downloads erlaube (Netzpolitik 31.05.2017).
Die Bundesnetzagentur hatte direkt nach dem Start angekündigt, StreamOn sorgfältig prüfen zu wollen. Damit begann sie anderthalb Monate später (Golem 16.05.2017), war jedoch bis August noch nicht zu einem Ergebnis gelangt (Tagesspiegel 27.08.2017). Im Oktober 2017 führte auch Vodafone ein Zero-Rating-Angebot in Deutschland ein (Netzpolitik 26.09.2017). Unter den Anbietern auf StreamOn finden sich neben Netflix und Amazon Prime Video auch die ZDF Mediathek und Funk.
Suche
Suchmaschinen sind das primäre Gateway zu Information im Internet. Google hält mit über 90% Marktanteil in Europa das Monopol auf Suche. Dass es seine Meinungsmacht missbraucht, indem es z. B. seinen eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber denen von Konkurrenten bevorzugt angezeigt hat, ist aktenkundig. Ende Juni 2017 verhängte die EU wegen Kartellrechtsverstoß ein Bußgeld in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google und drohte mit weiteren Strafzahlungen in Höhe von 5% des täglichen Umsatzes des Unternehmens, wenn es bis Ende September die inkriminierten Praktiken nicht ändert (SZ 27.06.2017). Google klagt gegen das Bußgeld und errichtete zugleich einen eigenständigen Shopping-Dienst in Europa, der nun bei der Versteigerung der Werbeplätze auf den Suchergebnisseiten gegen die Konkurrenten antreten muss (Bloomberg 26.09.2017). Zwei weitere Verfahren der EU-Kartellbehörde richten sich gegen Googles Marktmissbrauch beim Smartphone-Betriebssystem Android sowie im Anzeigenmarkt.
Hans Hege, damals noch langjähriger Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, sah die Gefahr, aber war skeptisch, was die vorhandenen Instrumente betrifft: „Es scheint so, dass weder die medienrechtliche Regulierung noch das Kartellrecht genügen, um die gefährdenden Effekte auf die Meinungsvielfalt, die von der Nutzung von Suchmaschinen ausgehen, abzubilden.“ (Hege/Flecken 2014: 240) Daher schlug er eine unabhängige, aus dem Rundfunkbeitrag öffentlich finanzierte und betriebene Suchmaschine vor allem für audio-visuelle Inhalte vor. Sie sei ein zeitgemäßerer Beitrag zur Vielfaltssicherung als viele von den Rundfunkanstalten produzierte Inhalte.
Eine Initiative für einen europäischen, öffentlich finanzierten Open Web Index (OWI) ist inzwischen vom Suchmaschinenexperten Dirk Lewandowski gestartet worden. Ob in das Projekt auch öffentlich-rechtliche Beitragsgelder fließen sollen, wird zu diskutieren sein. Dass sich die ÖRM nach Kräften an der Debatte und an dem Projekt beteiligen sollten, ist im Geiste von Hege vorgezeichnet.
Offene Standards und Freie Software
Der Universalversorgungsauftrag der ÖRM begründet den Anspruch auf freie Zugänglichkeit für alle Bürger. Die deutschen Anstalten lehnen daher Beschränkungen wie DRM und Geoblocking ab. – anders als die BBC, die selbst Beitragszahler auf Reisen außerhalb des Königreiches von ihrem Programm aussperrt.
Im selben Geist und Orientierungsauftrag in der digitalen Welt ist auch zu fordern, dass ÖRM für ihre Systeme und öffentlich verbreiteten Apps, Games u. a. Anwendungen streng auf die Einhaltung offener Standards achten und Freie Software (vgl. Grassmuck 2002) verwenden. In den Wissenschaften hat sich durchgesetzt, dass öffentliche Förderung an die Auflage gebunden ist, die Ergebnisse frei zugänglich, Open Access, zu veröffentlichen. Verblüffender weise gilt diese Anforderung noch nicht für öffentlich finanzierte Software. Daher hat die Free Software Foundation Europe (FSFE) mit zahlreichen Verbündeten im September 2017 die Kampagne „Public Money, Public Code“ gestartet. Auch hier sollten die ÖRM mit gutem Beispiel vorangehen und die von ihnen selbst oder in ihrem Auftrag erstellte Software freilizenzieren – im eigenen Interesse wie in dem ihrer Nutzer.
Public Open Space
Als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den 1990ern ins Netz ging, erstellten die Anstalten selbstverständlich ihre eigenen Websites. Als Mitte der Nullerjahre Social Media aufkamen, verlängerten sie ihre Angebote nach und nach auf Facebook, Twitter, Youtube u. a. Die aktuelle Strategie, wie wir sie bei Funk.net und in den Plänen zur Erweiterung ihrer Social Media-Aktivitäten bei BBC und ORF sehen, besagt, dass die ÖRM mit ihren Inhalten dorthin gehen müssten, wo sich die jungen Zielgruppen aufhalten.
Das Argument ist in der aktuellen Lage plausibel und doch bleibt die Bespielung von kommerziellen Drittplattformen problematisch. Zum einen haben die ÖRM keine Kontrolle über das Umfeld ihrer Angebote. Zudem sind die Konsequenzen problematisch, was Datenschutz, die Bereitstellung öffentlich finanzierter Inhalte auf kommerziellen Plattformen, deren Monetarisieren durch Werbung und Datenhandel und die Wiedererkennbarkeit öffentlich-rechtlicher Angebote betrifft.
Inhalte auf kommerzielle Plattformen zu stellen, befördert ihre Zugänglichkeit. Zugleich fördert es das Geschäftsmodell des jeweiligen Plattformbetreibers. Selbst wenn Facebook oder Youtube keine Werbung vor oder nach öffentlich-rechtlichen Beiträgen schaltet, erhöhen diese die Attraktivität und damit den Wert der Plattformen. ÖRM mögen frei von eigenen ökonomischen Interessen agieren, doch in Bezug auf die Förderung der ökonomischen Interessen von Facebook, Google & Co. ist mit der Frage zu rechnen, ob Beitragsgelder dafür auftragsgemäß und verhältnismäßig verwendet werden (so z. B. der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Justus Haucap (Welt 17.04.2017)).
Bei sozialen Netzen handelt es sich allenfalls de facto um öffentliche Räume, die aber privat betrieben werden und wie Shopping-Malls ihr jeweiliges Hausrecht erlassen. Damit machen sich ARD und ZDF von einzelnen Anbietern abhängig und sind deren Entscheidungen über AGB und technische Features ausgesetzt.
Das Primat des Content-Netzwerks und der einzelnen Formate bedroht zudem die Identität und Wiedererkennbarkeit des öffentlich-rechtlichen Angebots. Die starke Marke ZDF gelte im Internet „nur noch wenig, vielleicht gar nichts mehr“, schrieb ZDF-Intendant Bellut im Angebotskonzept von Funk.net. „Im Jugendangebot gilt nun das Primat des einzelnen Formats.“ (ARD und ZDF 2015: 7) Zugleich heißt es im Konzept:
„Die unterschiedlichen Formate des Jugendangebots müssen wiedererkennbar und untereinander verbunden sein. Diese einheitliche Tonalität muss sich über alle Plattformen und Ausspielwege erkennbar wiederfinden. Wichtig für den Erfolg des Angebots sind ein klares Profil und eine klare Haltung. … Das Jugendangebot wird weder selbst noch mit dem Label von ARD und ZDF prominent als Inhalteanbieter auftreten. Vielmehr soll das einzelne Format Akzeptanz, Erfolg und Bindung beim Nutzer bewirken. Auf YouTube wird dieses Prinzip bereits erfolgreich praktiziert: Die Zielgruppe abonniert nicht ein Multi-Channel-Netzwerk, sondern das Format an sich. … Nicht umsonst sind die erfolgreichsten Fanpages und Twitteraccounts nicht etwa ARD, ZDF oder RTL. Es sind Tatort, heute-show oder DSDS.“ (ARD und ZDF 2015: 11)
Dass das Jugendangebot seine Inhalte über zahlreiche Kanäle streuen soll, konzentriert auf einzelne Formate, ohne eigenes Label und dennoch erkennbar zu einem großen öffentlich-rechtlichen Ganzen verbunden, gleicht der Quadratur des Kreises.
Wie können sich ÖRM zu dem Dilemma der monopolistischen, US-amerikanischen Social Media-Plattformen verhalten? Grundsätzlich sind drei Strategien vorstellbar: Sie könnten ein Gütesiegel einführen, das frei flottierende Inhalte als öffentlich-rechtliche kenntlich macht, sie könnten und sollten auf Facebook, Youtube & Co einwirken, um zumindest die datenschutzrechtlichen Probleme anzugehen. Und schließlich könnten sie gemeinsam und mit Partnern eine eigene, starke Plattform aufbauen.
 Bio-, Öko-, TÜV-, Fair-Trade- und andere Gütesiegel signalisieren die Einhaltung bestimmter technischer, Umwelt-, sozialer usw. Qualitätsmerkmale, die in Kaufentscheidungen einfließen können. Auch bei informationellen Produkten und Dienstleistungen etablieren sich Siegel, z. B. für Datenschutz und Datensicherheit von Online-Shops, die Qualität von Gesundheitsinformationen, Alterskennzeichnung oder „Approved for Free Cultural Works”, das signalisiert, dass ein Werk unter einer Lizenz steht, die die Definition von freien kulturellen Werken erfüllt. Auf die gleiche Weise könnten Werke öffentlich-rechtlicher Provenienz gekennzeichnet werden, Werke, die im öffentlichen Auftrag und Interesse und nach den höchsten Qualitätsstandards produziert wurden. Ein solches Siegel würde idealerweise gleich auf paneuropäischer Ebene etabliert, und es könnte auf Werke anderer öffentlicher Wissenseinrichtungen mit ihren Qualitätssicherungssystemen erweitert werden, Museen, Bibliotheken, Hochschulen, aber auch auf zivilgesellschaftliche Wissensressourcen wie die Wikipedia. In der aktuellen Lage der vernetzten Öffentlichkeit wären „Qualitätsjournalismus“ oder „Fact Checked“ naheliegende Signale mit jeweils eigenen Voraussetzungen. Wie bei Freier Software und Freien Kulturellen Werken steht am Anfang eine Definition der auszuzeichnenden Werke mit überprüfbaren Kriterien. Allein die Debatte darüber wäre bereits hilfreich für Selbstverständnis und Außenwahrnehmung journalistisch-redaktioneller und kuratorischer Arbeit. Einmal als „starke Marke“ etabliert, böte ein solches Siegel Orientierung in einem zunehmend ununterscheidbaren Strom von Online-Botschaften, die eher der jeweiligen Plattform als den individuellen Absendern zugerechnet werden. Es würde händische und technische Filterung ermöglichen (‘zeige mir nur qualitätsgesicherte Beiträge in meinem Nachrichtenstrom’). Auch die Experten in der Salzburger Public Network Value Studie sehen es bei der Frage von Findability/Visability als bedeutend an, dass „glaubwürdige Logos“ sichergestellt werden, „die die Legitimität von Inhalten erhöhen, und dies speziell von Inhalten auf Plattformen dritter Parteien.“ (ORF/BR 2015: S. 72)
Bio-, Öko-, TÜV-, Fair-Trade- und andere Gütesiegel signalisieren die Einhaltung bestimmter technischer, Umwelt-, sozialer usw. Qualitätsmerkmale, die in Kaufentscheidungen einfließen können. Auch bei informationellen Produkten und Dienstleistungen etablieren sich Siegel, z. B. für Datenschutz und Datensicherheit von Online-Shops, die Qualität von Gesundheitsinformationen, Alterskennzeichnung oder „Approved for Free Cultural Works”, das signalisiert, dass ein Werk unter einer Lizenz steht, die die Definition von freien kulturellen Werken erfüllt. Auf die gleiche Weise könnten Werke öffentlich-rechtlicher Provenienz gekennzeichnet werden, Werke, die im öffentlichen Auftrag und Interesse und nach den höchsten Qualitätsstandards produziert wurden. Ein solches Siegel würde idealerweise gleich auf paneuropäischer Ebene etabliert, und es könnte auf Werke anderer öffentlicher Wissenseinrichtungen mit ihren Qualitätssicherungssystemen erweitert werden, Museen, Bibliotheken, Hochschulen, aber auch auf zivilgesellschaftliche Wissensressourcen wie die Wikipedia. In der aktuellen Lage der vernetzten Öffentlichkeit wären „Qualitätsjournalismus“ oder „Fact Checked“ naheliegende Signale mit jeweils eigenen Voraussetzungen. Wie bei Freier Software und Freien Kulturellen Werken steht am Anfang eine Definition der auszuzeichnenden Werke mit überprüfbaren Kriterien. Allein die Debatte darüber wäre bereits hilfreich für Selbstverständnis und Außenwahrnehmung journalistisch-redaktioneller und kuratorischer Arbeit. Einmal als „starke Marke“ etabliert, böte ein solches Siegel Orientierung in einem zunehmend ununterscheidbaren Strom von Online-Botschaften, die eher der jeweiligen Plattform als den individuellen Absendern zugerechnet werden. Es würde händische und technische Filterung ermöglichen (‘zeige mir nur qualitätsgesicherte Beiträge in meinem Nachrichtenstrom’). Auch die Experten in der Salzburger Public Network Value Studie sehen es bei der Frage von Findability/Visability als bedeutend an, dass „glaubwürdige Logos“ sichergestellt werden, „die die Legitimität von Inhalten erhöhen, und dies speziell von Inhalten auf Plattformen dritter Parteien.“ (ORF/BR 2015: S. 72)
Facebook und Youtube machen ohne Frage einen relevanten Teil der Netzöffentlichkeit aus. Sie können daher nicht ignoriert werden, sondern sollten dazu gebracht werden, sich als gute ‘corporate citizens’ im Netz zu verhalten. Dass die Goliaths nicht unangreifbar sind, zeigt der österreichische Jurist Max Schrems. Ende 2011 hatte er 22 Anzeigen gegen Facebook Irland Limited wegen Datenschutzverstößen beim Data Protection Commissioner in Irland gestellt, wo Facebook aus Steuergründen seinen europäischen Sitz hat, und die Initiative europe-v-facebook.org gestartet. Durch die Snowden-Enthüllungen zu Prism war klar geworden, dass Facebook und andere US-Unternehmen Daten ihrer europäischen Kunden an den Mutterkonzern in den USA exportieren und dort an die NSA weiterleiten. Danach konnte von einem „angemessenen Schutz“ europäischer Daten im Zielland keine Rede mehr sein. Dieser war aber Voraussetzung für den Datenexport in die USA unter dem „Safe Harbour”-Abkommen mit der EU. Wieder legte Schrems Beschwerden ein, diesmal bei den Datenschutzbehörden in Irland gegen Facebook und Apple, in Luxemburg gegen Skype und Microsoft und in Deutschland gegen Yahoo. Während die Datenschützer in Luxemburg und Deutschland die Angelegenheit verschleppten, wies der irische sie als „belanglos“ ab. Was Schrems mit einer Klage beantwortete, die im Oktober vom EuGH mit einem Urteil entschieden wurde, dass das EU-US Safe Harbour-Abkommen außer Kraft setzte. Schrems’ nächster Coup war es, die Sammelklage zu erfinden, die es in Europa bislang nicht gibt, indem er sich von mehr als 25.000 europäischen Facebook-Nutzern deren Ansprüche gegen das Unternehmen hat übertragen lassen. Die Frage der Zulässigkeit der Sammelklage hatte der Oberste Gerichtshof im September 2016 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, dessen Entscheidung für Ende des Jahres erwartet wird.
Plattform des öffentlichen Wissens
Die dritte Strategie ist eine eigene starke öffentlich-rechtliche Plattform, zusammen mit anderen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Wissens- und Kultureinrichtungen, gemeinsam mit den Nutzern und idealerweise gleich pan-europäisch.
Der wichtigste Impuls dazu kommt, wie so oft, von der BBC. Mit dem iPlayer hat sie die am stärksten genutzte öffentlich-rechtliche Plattform etabliert. In ihrem jüngsten Charter-Konzept kündigte sie an, zu einer offenen Plattform für institutionelle Partner, kreative Talente und Bürger werden zu wollen. Der Reith’schen Aufgaben-Trias fügte sie ‘Befähigen’ („to enable“) als vierte Mission hinzu. Diese Plattform – vermutlich eine Weiterentwicklung des iPlayers, dessen Broadcast-Charakter die BBC selbst bemängelt – will sie für britische „Ideeninstitutionen“ wie Museen, Theater, Festivals und Universitäten öffnen. Ob die BBC selbst originäre Inhalte für die offene Plattform produziert oder aus ihrem reichen Fundus schöpft, ist nicht klar. Unter dem Titel „Ideas Service“ sind zunächst zwei Portale vorgesehen: das bereits gestartete „BBC Arts“ für Kunst und Kultur und „A New Age of Wonder“ für Wissenschaft und Bildung. „Ideas Service“ richtet sich an ein britisches und ein globales Publikum.
Bei der Einführung der Idee einer offenen Plattform verweist die BBC auf die Wikipedia. Doch von der offenen Peer-Produktion der Online-Enzyklopädie ist das Modell der BBC weit entfernt. Eine gewisse Publikumsbeteiligung ist vorgesehen (Citizen Science, Produkttests, Bewertung von Piloten auf BBC Taster, zu Kreativität mit BBC-Inhalten ermuntern, um Rat fragen). Doch wehrt die BBC vehement den Verdacht ab, sie wolle ein zweites Youtube bauen, in dem die professionellen Inhalte von „User Generated Content“ überwältigt würden. Ob nicht-institutionelle Nutzer überhaupt etwas zur offenen Plattform beitragen, ob sie kommentieren und diskutieren dürfen, ist unklar. Angekündigt ist, dass sie sich registrieren sollen, um Inhalte zu personalisieren und ihnen mit Hilfe der Daten neue Themen und wichtige Fragen vorzustellen. Zuallererst geht es um ein kuratiertes Angebot im Goldstandard zusammen mit professionellen Partnern (BBC 2015: 57 ff.).
Eine offene Plattform, wie die BBC sie konzipiert, wünschen sich Dörr/Holznagel/Picot (2016) auch in Deutschland. In ihrem Gutachten zum öffentlich-rechtlichen Auftrag im Internet-Zeitalter schlagen sie neben der Vernetzung auf der Plattform, die sie „Public Open Space“ nennen, vor, öffentlich-rechtliche Produktionen „auch ausgewählten Dritten wie Gebietskörperschaften, NGOs oder anderen Verbänden mit berechtigtem Interesse zur Verfügung“ zu stellen.
Die eigene Plattform zog sich auch als roter Faden durch das Symposium „Auftrag der Zukunft: Agenda und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von morgen“, zu der die ARD-Generalsekretärin Susanne Pfab am 10.03.2017 an die Humboldt-Universität zu Berlin geladen hatte. Aus der Wissenschaften drängten unter anderem Martin Eifert (Professor für Öffentliches Recht an der Humboldt-Universität), Matthias Cornils (Professor für Medienrecht, Kulturrecht und öffentliches Recht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz) und Karl-Eberhard Hain (Professor für Öffentliches Recht und Medienrecht an der Universität zu Köln), aufgrund der genannten Problematik der Drittplattformen in diese Richtung zu gehen. Jan Metzger (Intendant von Radio Bremen) stellte ein zentrales Portal, in dem sich die Nutzer sicher fühlen könnten, an die erste Stelle seiner Prioritätenliste. Es könnte nicht nur die Angebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio bündeln, sondern, ähnlich wie bei der BBC, auch für andere Kultureinrichtungen geöffnet werden, so Metzger.
1. Kooperation der ÖRM. Wenn die ÖRM tatsächlich die Initiative zu einer solchen Vernetzung ergreifen, sind andere ÖRM die naheliegendsten Partner, nicht nur im selben Land (wie ARD und ZDF bei Kika, Funk usw.), sondern über Grenzen hinweg. Ein Beispiel dafür, dass Kulturen medial näher rücken können, ist das 1984 von den Öffentlich-Rechtlichen in Österreich, der Schweiz und Deutschland gegründete 3sat. Die französisch-deutsche Kooperation Arte, seit 1992 auf Sendung und seit 1996 im Internet, zeigt, dass ein gemeinsames Programm auch über Sprachgrenzen hinweg funktioniert. Als das neue Jugendangebot von ARD und ZDF noch trimedial konzipiert war, hatte sich eine Arbeitsgruppe eingehend mit den Jugendangeboten BBC3 (GB), NPO3 (Niederlande), DR3 (Dänemark) und PO3 (Norwegen) beschäftigt (ARD/ZDF 2013a: 11). Diese Sender würden sich für Kooperationen anbieten, für Programmaustausch, gemeinsame Formatentwicklung und Koproduktionen. Solche Partnerschaften würden helfen, Europa informationell und kulturell zusammen wachsen zu lassen. Der Blick zu unseren Nachbarn ist für die U30 ebenso attraktiv wie der in die USA. Die Privaten füllen große Teile ihrer Sendezeit mit angekauften US-Produktionen (womit sie gegen den Rundfunkstaatsvertrag verstoßen, demnach der Hauptteil des fiktionalen Programms aus europäischen Produktionen bestehen muss (Die Medienanstalten, Programmbericht 2014)). Hier können sich die ÖRM mit einer europäischen Vernetzung klar abgrenzen. Der natürliche Rahmen, um eine solche junge europäische Öffentlichkeit auf den Weg zu bringen, ist die European Broadcasting Union (EBU).
2. Kooperation mit öffentlichen Wissensinstitutionen. Bei den weiteren öffentlichen Kultureinrichtungen drängt sich, noch ganz nach dem Vorbild der BBC, Europeana auf. Das Verbundprojekt europäischer Nationalbibliotheken wurde im April 2005 von sechs Staatschefs auf den Weg gebracht und ging im Februar 2009 mit über 1.000 teilnehmenden Institutionen und mehr als 4,5 Millionen digitalen Objekten online. Aktuell zeigt die Liste der Quellen über 53 Millionen Digitalisate aus Europas Bibliotheken, Museen, Galerien und Archiven. Europeana ist dem Erhalt, der Zugänglichkeit und Weiternutzung des Kulturerbes verschrieben und hat seine Prinzipien in der Europeana Charta zum Gemeingut kodifiziert. Die Bestände umfassen neben Text und Bild auch Tondokumente, Videos und 3D-Objekte. Sie werden in Sammlungen, Ausstellungen und Galerien organisiert. Um die Weiternutzung zu fördern, finden immer wieder Video-Remix-Wettbewerbe oder Crowdfunds für Kulturerbeprojekte mit sozialer Wirkung statt. Europeana stellt bereits ein Europa umspannendes Netzwerk dar, bei dem alle Sammlungsobjekte über ihre Metadaten auf einer multilingualen Plattform präsentiert und durchsucht werden können, die digitalen Objekte selbst aber auf der Site und unter der Hoheit der jeweiligen Einrichtung verbleiben. Eine Föderation also, die ein Modell auch für die Vernetzung der Rundfunkanstalten sein könnte. Bei weiteren öffentlichen Kultureinrichtungen wäre an die Zentralen für politische Bildung und die Landesbildstellen in Deutschland oder den Medienservice des österreichischen Bundesministeriums für Bildung zu denken. Auf europäischer Ebene würde sich eine Zusammenarbeit mit Erasmus+, dem Austauschprogramm für Schüler, Auszubildende und Studierende der Europäischen Union anbieten, sowie dem aus der EU-Jugendstrategie hervorgegangenen Strukturierten Dialog.
3. Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen. NGOs, die die drei ZDF-Gutachter zurecht in die Offene Plattform einbeziehen wollen, spielen eine wichtige Rolle bei der Aushandlung der digitalen Gesellschaftsordnung, bei der Verteidigung von Grundrechten im Netz, allen voran der Meinungsfreiheit und dem Schutz vor Überwachung, sowie bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Dazu gehören die 2002 gegründete European Digital Rights Initiative (EDRi) und die 2004 in UK gegründete Open Knowledge Foundation (OKF), die inzwischen auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv ist, sowie nationale Initiativen wie Quintessenz.at, Netzpolitik.org und La Quadrature du Net.
Die zivilgesellschaftliche, qualitätsgesicherte und freie Enzyklopädie Wikipedia, drängt sich in diesem Zusammenhang derart auf, dass fast alle Plattformvorschläge sie erwähnen und sei es nur als Beispiel für die eindrucksvolle Stärke offener Kooperation. Die Wikipedia ist eines der am meisten frequentierten Informationsangebote im Internet, gerade unter jüngeren Zielgruppen. Gemäß der These ‘Wenn jungen Menschen nicht zu uns kommen, müssen wir dorthin gehen, wo sie sich informieren’ läge Wikipedia daher viel näher als Facebook oder Youtube. Audiovisuelle Beiträge mit Zeitgeschichte oder Erklärstücken wären eine willkommene Bereicherung für die freie Enzyklopädie. Leonhard Dobusch, neues Mitglied des ZDF-Fernsehrates für das Thema Internet, bezeichnete auf seinem Vortrag auf der re:publica 2017 ZDF und Wikipedia als Traumpartner, die bislang nur noch nicht zueinander gefunden hätten. Die Einschränkungen, die Dörr/Holznagel/Picot (2016) vornehmen (nur Inhalte „mit spezifischem Zuschnitt (z. B. regionaler Bezug, besondere gesellschaftliche Gruppen)“, „mit berechtigtem Interesse“) sind jedoch unverständlich. Zumal die Autoren sich eine Stärkung der kulturelle Archivfunktion sowie des Open Access öffentlicher Inhalte versprechen. Für eine Weiternutzung in der Wikipedia ist eine Freilizenzierung notwendige, aber auch schon hinreichende Voraussetzung. Für eine Kooperation von ÖRM und Wikipedia gibt es auch schon Präzedenzfälle wie den gemeinsamen Faktencheck von ZDF und Wikipedia zur Bundestagswahl 2013. Beide, ÖRM und Wikipedia sind in einer Neuorientierung auf Webvideo, ein Weg, den sie zusammen gehen können.
4. Kooperation mit Nutzern. Wäre in einem Public Open Space auch Raum für Nutzerbeiträge und offenen Austausch nach Art von Youtube oder Facebook denkbar? Unmöglich wäre es nicht, wenn es den politischen Willen gäbe, die erforderliche Mittel bereitzustellen. Und es gibt Hinweise, dass es zu den Erwartungen der Gesellschaft an die Öffentlich-Rechtlichen gehört. Die Public Network Value-Studie der Universität Salzburg ergab, dass nach Expertenmeinung die Platzierung von öffentlich-rechtlichen Angeboten in Sozialen Netzwerken und die Entwicklung eines eigenständigen Sozialen Netzwerks in der gesellschaftlichen Erwartungshaltung gleichauf liegen (ORF/BR 2015: 81).
Markus Hündgen, Veranstalter des Deutschen Webvideopreises, fordert genau das: Im zunehmend wichtigen Bereich der Webvideos klaffe eine Lücke: journalistische, edukative und künstlerische Inhalte. Ein Marktversagen, dem durch ein „öffentlich-rechtliches YouTube“ begegnet werden müsse, das ein werbefreies Umfeld für qualitätsvolle Inhalte bieten würde. Den Mehrwert, so Hündgen, den eine offene, öffentlich-rechtliche Kontributorenplattform für Video den Nutzern bietet, ist genau dieses Umfeld von journalistischen, edukativen und künstlerischen Inhalten, die Werbefreiheit und die andere Kultur, die sie hervorbringt (die fehlende Monetarisierung spricht andere Produzentinnen an, als diejenigen, die hoffen, mit Youtube-Videos ihren Lebensunterhalt zu verdienen). Zudem wäre eine Brücke zu redaktionellen Bereichen der ÖRM attraktiv, die qualitätvolle Inhalte kuratieren und in einen eigenen Kontext stellen. Drei Beispiele zeigen, wie ÖRM Nutzer-Beiträge wertschätzen können:
- ABC Open, das Kontributorenportal der Australian Broadcasting Corporation. Jeden Monat wird dafür zur Beteiligung an neuen thematische Projekten aufgerufen. Dafür bietet ABC Workshops und Tutorials. Die Videos werden auf Vimeo hochgeladen und auf der Plattform Open.abc.net.au präsentiert.
- Das Oral History-Projekt von BBC Radio 4 mit der British Library. Die Kontributoren produzieren hier nicht etwa „UGC“, sondern Beiträge für ein nationales Kulturerbearchiv.
- Kioski, das Online-Jugendangebot des finnischen Rundfunks, ist auf Twitter, Facebook und Instagram präsent. Daneben kuratiert es aber auch Webvideos Dritter auf die eigene Site – eine Möglichkeit, Orientierung zu bieten, Qualität hervorzuheben und den Austausch mit den Nutzern zu intensivieren. Außerdem sind Filmemacher und Bands eingeladen, ihre noch unveröffentlichten Werke auf der Plattform einzustellen.
4. Ein Raum der deliberativen Demokratie. Eine Gruppen von Medien- und Kommunikationswissenschaftlern diskutiert ein weiteres Modell, das für den Public Open Space relevant ist: ein „civic commons online“, also etwa: eine staatsbürgerliche Online-Allmende (z. B. Bua 2009). Ausgangspunkt ist ein Habermasianisches Modell von deliberativer Demokratie, die auf Räume der Öffentlichkeit angewiesen ist, die frei sind von staatlichem und wirtschaftlichem Einfluss. Der zweite Schritt ist eine Analyse des Internet als weitgehend kommerzialisiertem Raum, der die Hoffnungen auf Demokratisierung der Öffentlichkeit nicht erfüllt hat. Als conclusio stellen sich die ÖRM als Lösung für die Mängel des Internet dar. Informationen sind ihre Kernkompetenz und entscheidend für die Herausbildung von öffentlicher Meinung durch rationalen, kritischen Diskurs, die Habermas von der privaten, ungeprüften Meinung unterscheidet. Außerdem sind ÖRM unabhängig vom Staat und doch öffentlich finanziert. Was sie geeignet mache, so die Theorie, ein civic commons zu organisieren.
Ramsey (2013) untersucht nach einer Zusammenfassung der Debatte über civic commons, ob die BBC geeignet sei, einen solchen deliberativen Raum im Netz zu etablieren. Sein Fazit ist verhalten positiv. Ein solches Unterfangen würde unmittelbar zur Erfüllung des Auftrags der BBC beitragen. Sie verfüge fraglos über die Kompetenzen und das Vertrauen, die dafür nötig sind. Schließlich könnte sie damit die Beziehung zu ihren Beitragszahlern vertiefen und das civic commons für die Diskussion über die BBC selbst verwenden. Ramsey sieht jedoch auch Hindernisse: Marktfundamentalisten, für die jegliche Online-Aktivität der BBC ein Affront ist, die Kosten, die die BBC unter Spardruck und aus den ohnehin nur 5% der Beitragseinnahmen für Online kaum schultern könnte, und das Gerechtigkeitsargument gegenüber den 20% der Haushalte in Britannien, die zu dem Zeitpunkt noch keinen Internetanschluss hatten (Ramsey 2013: 21).
Handlungsempfehlungen
Wie die Parameter des Bildungsauftrags im digitalen Zeitalter in den drei betrachteten Ländern jeweils erfüllt werden, wäre lohnender Gegenstand einer empirischen Untersuchung. Die vorliegenden Überlegungen sollen abschließend in den zentralen Punkten zusammengefasst werden:
- Eine breite gesellschaftliche Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Auftrags
Wie alle gesellschaftlichen Großthemen ist Medienpolitik komplex. Da es um die Grundlage der öffentlichen Meinungsbildung über alle Themen geht und angesichts der eingangs geschilderten Herausforderungen, ist hier mehr noch als bei anderen Themen eine breite gesellschaftliche Debatte über ihre Zukunft unerlässlich. Breitere Aufmerksamkeit erreichen bislang kaum mehr als Versagensvorwürfe gegen Berichterstattung (z. B. über Geflüchtete oder Rechtspopulisten), Lobbyattacken von Privatmedienverbänden (z. B. von Mathias Döpfner, Springer-Vorsitzender und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, der jüngst die Öffentlich-Rechtlichen als „Staatsfernsehen … nach dem Geschmack von Nordkorea“ bezeichnete (Rede auf der BDZV- Mitgliederversammlung am 18.09.2017)) und das Aufregerthema Beitragserhöhung. Dagegen finden die eigentlichen Debatten über medienpolitische Entscheidungen weitgehend unbemerkt in einem kleinen Kreis von Fachpolitikern, Lobbyisten und akademischen Medienrechtlern statt. Diese Debatte über die digitale Zukunft der ÖRM muss auf breitere Füße gestellt werden.
Die BBC ist hier Vorbild mit einer breiten Beteiligung von fast 200.000 Eingaben bei der jüngsten Konsultationen zur Zukunft der BBC und zivilgesellschaftlichem Engagement wie Our Beeb von openDemocracy.
Aus ihrer eigenen Begründungslogik und umso mehr mit dem Schritt in den Kulturraum Internet müssen ÖRM und Politik aktive Schritte zu einer solchen qualifizierten und konstruktiven Debatte auch in Österreich und Deutschland unternehmen. Ein Vorbild dafür ist die Internet Enquete des deutschen Bundestages von Mai 2010 bis April 2013, an der neben den Abgeordneten und den von den Fraktionen berufenen Experten auch alle Bürger über das Beteiligungssystem Adhocracy teilnehmen konnten.
- Die öffentlich-rechtlichen Medien vom Internet aus neu denken
Die Idee, die jungen Publika säßen weiterhin vor dem Fernseher, müssen die ÖRM genauso abgelegen, wie die lang gehegt Überzeugung, das Internet sei eine Modeerscheinung. Die Zukunft der Meinungsbildung ist online. Linear ist nur eine weitere Playlist. Digitalisierung bewirkt Verjüngung des Publikums. Beides bedingt eine Verjüngung der Produzenten und Öffnung nach außen (von Kooperationen bis Hackdays).
Auch die Redaktionen, die Public Value im Internet schaffen, und die Gremien, die sie bei der Erfüllung der politischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft überwachen, werden eine dem Internet angemessene Form finden müssen. Politisch muss das Ziel sein, sämtliche Hindernisse für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags im Internet
zu beseitigen und die rechtlichen Garantien von Entwicklungs- und Innovationsfreiheit effektiv zu sichern. Ein Schlüsselkonflikt dafür ist der um das Verbot der Presseähnlichkeit (Medienpolitik.net 12.06.2017).
- Errichtung einer offenen Plattform
Für Vernetzung, Europäisierung, Sichtbarkeit und Offenheit braucht es eine starke Plattform im Verbund der europäischen öffentlich-rechtlichen Medien und gemeinsam mit öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Wissensinstitutionen. Der Bildungsauftrag stünde natürlich auch bei dieser Plattform zentral, ebenso der von der BBC neu formulierte Auftrag, ihr Publikum zu befähigen und zu aktivieren. Zudem umfasste sie eine Nachrichten-Plattform, da die Unterrichtung über aktuelle Ereignisse wesentliches Element eines weit gefassten Bildungsauftrags ist, eine Plattform für öffentliche Deliberation als Habermas’ Kaffeehaus in digitaler Form und Bindeglied zwischen der Nachrichten-Plattform und den parlamentarischen Entscheidungsprozessen, sowie ein Archiv. Errichtet würde sie mit offenen Standards und Freier Software als Leutturm für eine Grundrechte sichernde, offene digitale Infrastruktur.
- Vermittlung digitaler Medienkompetenz
Auf dem Weg ins Internet müssen die ÖRM ihre Nutzer begleiten. Eine digitale Alphabetisierung meint die Erweiterung der grundlegenden Kulturtechniken der Bild-, Schrift-, und Zahlbeherrschung um ihre digitalen Dimensionen sowie spezifische informatische Kompetenzen. Neben Wissensvermittlung und kritischem Urteilsvermögen stehen dabei die aktiven, produktiven, expressiven Kompetenzen im Vordergrund. Um Menschen zu Handlungskompetenz in der digitalen Umwelt zu befähigen, braucht es digitale Gestaltungskompetenzen. Nicht wir sollen lernen, die Maschinen zu bedienen, sondern sie sollen uns dienen. Dazu müssen wir sie meistern und nach unsere Bedürfnissen gestalten, nicht nur, was das Entwickeln, Anpassen und kreative Umwidmen von Soft- und Hardware, von Netzen und Medien angeht, sondern auch für die Gestaltung von Politik und Gesellschaft. Die ÖRM müssen ihre Bildungsangebote für digitale Medien- und Handlungskompetenz ausbauen. Ein Schritt in die richtige Richtung ist es, die Einrichtungen für Aus- und Fortbildung von journalistischen und technischen Rundfunkmitarbeitern wie die BBC Academy für die Öffentlichkeit zu öffnen.
- Kategoriale Verschiedenheit öffentlich-rechtlicher Medien
Bürger und Öffentlich-Rechtliche haben eine Art Rousseauschen Gesellschaftsvertrag miteinander geschlossen: wir alle beauftragen, bezahlen und kontrollieren eine journalistisch-redaktionelle Selbstbeobachtung der Gesellschaft im öffentlichen Interesse. Dieser Vertrag schafft einen vom Markt kategorial verschiedenen Raum. Das Gegenüber der Öffentlich-Rechtlichen sind keine Konsumenten, sondern Bürger. Wie das deutsche Verfassungsschutzgericht immer wieder betont hat, unterliegen öffentlich-rechtliche und privatwirtschaftliche Medien ihrer jeweiligen Eigenrationalität.
Ein Großteil der Probleme, vor denen die ÖRM heute stehen, beruht auf einem schlichten Kategorienfehler. Dazu gehören die Anfechtungen der Marktfundamentalisten, die ihn auf eine subsidiäre Funktion zum Markt reduzieren wollen oder einen fairen Wettbewerb fordern, wo es keine geben kann, da ein öffentlich beauftragtes Angebot etwas völlig anderes ist als ein Marktangebot. Dazu gehören die von der EU geforderten unsinnigen und kostspieligen Marktauswirkungstests, die Äpfel mit Birnen vergleichen sollen. Dazu gehört auch die Selbstvermarktlichung der ÖRM, die so für die Beitragszahler immer ununterscheidbarer von privatwirtschaftlichen Medien werden.
In Zeiten, in denen der öffentliche Sektor durch Public-Private-Partnerships ausgehöhlt und in der politischen Debatte immer stärker gegenüber dem Primat des Marktes delegitimiert wird und die Rundfunksouveräne sich als Konsumenten verstehen und eine Wahlfreiheit zwischen ÖRM und Netflix einfordert, haben wir mehr zu verlieren als die journalistische Selbstbeobachtung im öffentlichen Auftrag. Die Grundlagen einer solidarischen, sozialen, demokratischen Gesellschaft stehen auf dem Spiel.
Öffentlich-rechtliche Medien haben eine digitale Zukunft. Aber nur, wenn sie selbst, die Politik und die Gesellschaft sie in ihrer Eigenrationalität, die sich aus dem Public Value Auftrag ergibt, erkennen und stärken. Wenn die Gesellschaft sie als ihre Medien umarmt und tatsächlich, nicht nur formalrechtlich diese Medien beauftragt, finanziert und kontrolliert.
Literatur
Allen, David (2015) BBC Computer Literacy Project: Taking a look back at the future, 12.09.2015
ARD (2016) ARD-Bericht 2015/16 und ARD-Leitlinien 2017/18 für Das Erste. Bericht der ARD über die Erfüllung ihres Auftrags, über die Qualität und Quantität ihrer Angebote und Programme sowie über die geplanten Schwerpunkte (§ 11e Rundfunkstaatsvertrag), o.O. 2016
ARD (2016a) Genrespezifische Qualitätskriterien
ARD (2016b), Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Zeiten der Digitalisierung der Medien, November 2016
ARD/ZDF (2013) Gemeinsamer Jugendkanal von ARD und ZDF. Konzept zur Vorlage bei der Jahreskonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 23. bis 25. Oktober 2013
ARD/ZDF (2013a) Erläuterungen zu den Punkten 2 bis 4 des TOP 1.1 des MPK-Beschlusses vom 25. Oktober 2013
ARD/ZDF (2015) Konzept des neuen Jugendangebots von ARD und ZDF, Juni 2015
ARD/ZDF (2016) ARD/ZDF-Onlinestudie 2016
Baacke, Dieter (1973): Kommunikation und Kompetenz. Grundlegung einer Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien, Juventa, München
Bartenberger, Martin (2010) Mit Public Value zur Gegenhegemonie? Versuch einer historisch-materialistischen Policy Analyse des neuen ORF-Gesetzes, Diplomarbeit Uni Wien, Politikwissenschaft, im September 2010
BBC (2004) Building Public Value: Renewing the BBC for the Digital World, Juni 2004
BBC (2015) British, Bold, Creative. The BBC’s programmes and services in the next Charter, September 2015
BBC (2015a) Public Value Assessment of the re-invention of BBC Three online and related proposals. Submission to the BBC Trust, January 2015
BBC Trust (2010), BBC On-demandPerformance review, Mai 2010
Berger, Jake (Hrsg.) (2012) Guide To The BBC’s Archives 2012. What’s in the Archives, and how to use them
Beuth, Patrick (2017) Heiko Maas: Auf Hass gezielt, die Meinungsfreiheit getroffen. Soziale Netzwerke sollen rechtswidrige Inhalte schneller löschen. Doch den Gesetzentwurf von Justizminister Maas zerpflücken nun Juristen, Bürgerrechtler und Industrie, Zeit, 16.03.2017
Bohdal, M. & R. Belfin (2014) Öffentlich-rechtliche Angebote auf dem Prüfstand. Ein Blick in die Praxis in Österreich und Europa, Schriftenreihe der Rundfunk und Telekom Regulierungs- GmbH, Band 1/2014, Januar 2014
Bonfadelli, Heinz; Ursula Schwarb, Sara Signer und Edzard Schade (2007) Öffentlicher Rundfunk und Bildung. Angebot, Nutzung und Funktionen von Kinderprogrammen. Forschungsbericht zu Handen des Bundesamtes für Kommunikation, Zürich, im Februar 2007
Borgesius, Frederik J. Zuiderveen; Damian Trilling; Judith Möller; Balázs Bodó; Claes H. de Vreese; Natali Helberger (2016) Should we worry about filter bubbles?, Internet Policy Review, Volume 5, Issue 1, 31.03.2016
BRU (1985) Broadcast Research Unit (BRU), The Public Service Ideain British Broadcasting – Main Principles, London 1985
Bua, Adrian (2009) Realising Online Democracy: A Critical Appraisal of Online Civic Commons, Compass, London, Mai 2009
Bundesverfassungsgericht (1961) 1. Rundfunkentscheidung, BVerfGE 12, 205, 28.02.1961
Bundesverfassungsgericht (1971) 2. Rundfunkentscheidung, BVerfGE 31, 314, 27.07.1971
Bundesverfassungsgericht (1987) 5. Rundfunkentscheidung, BVerfGE 74, 297, 24.03.1987
Bundeszentrale für Politische Bildung (2012) Deutsche Fernsehgeschichte in Ost und West: Bildungs- und Schulfernsehen, 30.08.2012
Coyle, Diane und Christopher Woodard (2010) Public Value in Practice. Restoring the ethos of public service, BBC Trust, London 2010
Crawford, Susan P. (2008) The Radio and the Internet, 23 Berkeley Tech.
L.J. 933 (2008)
DCMS (2006) An Agreement Between Her Majesty’s Secretary of State for Culture, Media and Sport and the British Broadcasting Corporation, Juli 2006
DCMS (2015) Department of Culture, Media & Sports, Green Paper BBC Charter Review Public consultation, 16.07.2015
DCMS (2016), Royal Charter for the continuance of the BBC, Dezember 2016
DCMS (2016a) An Agreement Between Her Majesty’s Secretary of State for Culture, Media and Sport and the British Broadcasting Corporation, Dezember 2016
Decker, Oliver; Johannes Kiess, Elmar Brähler (Hg.) (2016) Die enthemmte Mitte, Autoritäre und rechtsextreme Einstellung in Deutschland. Die Leipziger »Mitte«-Studie 2016, in Kooperation mit Otto Brenner Stiftung, Heinrich Böll Stiftung und Rosa Luxemburg Stiftung, Psychosozial-Verlag 2016
Donaubauer, Stefan Florian (2011) Geschichte und Fernsehen 1964 – 2004: 40 Jahre Geschichte im Bayerischen Fernsehen, Dissertation an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, 2011
Donders, Karen und Hallvard Moe (2011) Exporting the Public Value Test. The Regulation of Public Broadcasters’ New Media Services Across Europe, Nordicom, University of Gothenburg
Dorer, Johanna (2004) Another Communication is Possible. Triales Rundfunksystem und die Geschichte der Freien Radios in Österreich, in: medien & zeit 3/2004, S. 4-15
Dörr, Dieter, Bernd Holznagel und Arnold Picot (2016) Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud, im Auftrag des ZDF, November 1016
Eckhardt, Josef (2005) Wie erfüllt der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Kulturauftrag. Empirische Langzeitbetrachtungen. Arbeitspapiere des Instituts für Rundfunkökonomie an der Universität zu Köln, Heft 202, Juli 2005
El-Bermawy, Mostafa M. (2016) Your Filter Bubble is Destroying Democracy, Wired 18.11.2016
Emek (2015) Eidgenössische Medienkommission, Diskussionsbeiträge und Gestaltungsvorschläge zu Service-public-Medien in der Schweiz, 11.12.2015
Epstein, R., & Robertson, R. E. (2015) The search engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of elections, Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(33), E4512–E4521.
EU (1997) Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte (EGV)
EU Kom. 2000: Mitteilung der Kommission über Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa, Brüssel, den 20.9.2000, KOM(2000) 580 endgültig.
EU Kom. (2001) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Amtsblatt Nr. C 320 vom 15.11.2001, S. 0005 – 0011
EU Kom. (2007) Schreiben der Kommission an die Bundesregierung, Betreff: Staatliche Beihilfe E 3/2005 (ex- CP 2/2003, CP 232/2002, CP 43/2003, CP 243/2004 und CP 195/2004) – Deutschland Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland, Brüssel, den 24.IV.2007 K(2007) 1761 endg.
EU Kom. (2009) Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 2009/C 257/01, 27.10.2009
EU-Kom. (2009a) Mitteilung an die Republik Österreich zu Staatliche Beihilfe E 2/2008 (ex CP 163/2004 und CP 227/2005) – Finanzierung des ORF, Brüssel, 28.10.2009, K(2009)8113 endgültig
EU Rat (1999) Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten vom 25. Januar 1999 über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (1999/C 30/01)
Frick, Karin; Jakub Samochowiec; Detlef Gürtle (2016), Öffentlichkeit 4.0. Die Zukunft der SRG im digitalen Ökosystem, GDI Gottlieb Duttweiler Institut, Zürich
Garrett, Kelly (2009) Echo chambers online?: Politically motivated selective exposure among Internet news users, CMC, Volume 14, Issue 2, January 2009, S. 265–285
GI (2008) Gesellschaft für Informatik, Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule. Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I, 24.01.2008
GI (2016) Gesellschaft für Informatik, Dagstuhl-Erklärung: Bildung in der digitalen vernetzten Welt
Giersch, Volker (2008) Ein nur noch seltenes Paar. öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Jugend – Strategien gegen den Generationenabriss, in: ARD-Jahrbuch 2008
Grassmuck, Volker (1990) „I’m alone, but not lonely“. Japanese Otaku-Kids colonize the Realm of Information and Media, in: Mediamatic vol. 5 #4, Amsterdam, December 1990.
Grassmuck, Volker (2002) Freie Software zwischen Privat- und Gemeineigentum, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn
Grassmuck, Volker (2014) Von Daseinsfürsorge zu Public Value, in: Dieter Klumpp, Klaus Lenk, Günter Koch (Hrsg.), Überwiegend Neuland. Zwischenbilanzen der Wissenschaft zur Gestaltung der Informationsgesellschaft, edition sigma, Berlin, 2014
Grassmuck, Volker (2016) Das Jugendangebot ist das Nadelöhr für den Fortbestand öffentlich-rechtlicher Medien, Grundversorgung 2.0, 17.06.2015
Grassmuck, Volker (2017) Stellungnahme zum ZDF-Gutachten, für Anhörung des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik des Landtages Rheinland-Pfalz, 12. Januar 2017
Hachmeister, Lutz und Till Wascher (2017) Wer beherrscht die Medien? Die 50 größten Medien- und Wissenskonzerne der Welt, Herbert von Halem Verlag, Köln 2017
Highfield, Ashley (2007) BBC Director Future Media and Technology, Keynote speech given at MIPTV in Cannes, 18 April 2007
Hagen, Wolfgang (2005). Das Radio. Zur Geschichte und Theorie des Hörfunks – Deutschland/USA, Fink Verlag München.
Hege, Hans; Eva Flecken (2014) Debattenbeitrag: Gibt es ein öffentliches Interesse an einer alternativen Suchmaschine?, in: Birgit Stark, Dieter Dörr, Stefan Aufenanger (Hrsg.), Die Googleisierung der Informationssuche. Suchmaschinen zwischen Nutzung und Regulierung, Reihe: Media Convergence / Medienkonvergenz 10, De Gruyter 2014
Helmers, Sabine; Ute Hoffmann, Jeanette Hofmann (2000) Internet… The Final Frontier: An Ethnographic Account. Exploring the cultural space of the Net from the inside, Schriftenreihe der Abteilung “Organisation und Technikgenese” des Forschungsschwerpunktes Technik-Arbeit-Umwelt am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, FS II 2000
Hoffmann, Dagmar (2016) Bildungsauftrag und Informationspflicht der Medien, Dossier Medienpolitik, Bundeszentrale für politische Bildung, 09.12.2016
Horizont, Vertrauen in Medien nimmt weiter ab, 15.03.2017
Hughes, Jacquie (2015) The BBC Trust: a work in progress, Our Beeb, 24.04.2015
Karmasin, Matthias; Daniela Süssenbacher; Nicole Gonser (Hrsg.) (2011) Public Value. Theorie und Praxis im internationalen Vergleich, VS Verlag, Springer, Wiesbaden
Keese, Christoph (2011) Warum Verlage gegen die ARD klagen, Der Presseschauder 23.06.2011
KMK (2012) Medienbildung in der Schule, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012
KMK (2016) Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz, Berlin 08.12.2016
Koch, Wolfgang und Beate Frees (2016) Dynamische Entwicklung bei mobiler Internetnutzung sowie Audios und Videos. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2016, Media Perspektiven 9/2016
Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014) Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks, Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(24), 8788-8790
Krämer, Heike; Gabriele Jordanski und Lutz Goert (2017) Medien anwenden und produzieren – Entwicklung von Medienkompetenz in der Berufsausbildung, Wissenschaftliche Diskussionspapiere Heft 181, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Bonn März 2017
Krüger, Uwe (2013) „Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse, Dissertation, Medienwissenschaft, Uni Leipzig, Köln: Halem-Verlag
Kupferschmitt, Thomas (2016) Online-Videoreichweite steigt bei weiter geringer Nutzungsdauer. Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2016, Media Perspektiven 9/2016
Lilienthal, Volker/Weichert, Stephan/Reineck, Dennis/Sehl, Annika/Worm, Silvia (2014) Digitaler Journalismus. Dynamik – Teilhabe – Technik. Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Band 74. Leipzig: Vistas
Mazzucato, Mariana (2015) The Future of the BBC: the BBC as Market Shaper and Creator, LSE Media Policy Project, 14.10.2015
MCMS (2016) UK Secretary of State for Culture, Media and Sport, Royal Charter for the continuance of the BBC, Dezember 2016
Medienanstalten, Die (2016) MedienVielfaltsMonitor, Ergebnisse 1. Halbjahr 2016, Anteile der Medienangebote und Medienkonzerne am Meinungsmarkt der Medien in Deutschland, Berlin 2016
Mikos, Lothar (2008) Bildung durch Unterhaltung, in: Deutscher Kulturrat, Politik und Kultur Dossier Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, September – Oktober 2008: 30
Moore, Mark Harrison (1995) Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard College
Moore, Mark Harrison (2013) Recognizing Public Value, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Naderhirn, Johannes (2009) Das Österreichische Fernsehen – demokratiepolitischer Bildungsauftrag oder Quoter? Dissertation, Universität Wien. Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft
OECD (2017) Bildung auf einen Blick 2017. OECD-Indikatoren, deutsche Übersetzung BMBF, Berlin
Oremus, Will (2017) The Media Have Finally Figured Out How to Cover Trump’s Lies, Slate, 23.03.2017
ORF (2008) Public Value Bericht 07/08
ORF (2011) Jugend und Gesellschaftspolitik. Öffentlich-rechtliche Qualität im Diskurs, Institut für Jugendkulturforschung, Wien 2011
ORF und BR (2015) Medienqualität 4.0. Public Network Value Studie, Wien
Papier, Hans-Jürgen und Meinhard Schröder (2010), Rechtsgutachten zur Abgrenzung der Rundfunk- und Pressefreiheit zur Auslegung des Begriffs der „Presseähnlichkeit“ und Anwendung des Verbots nicht sendungsbezogener presseähnlicher Angebote gemäß § 11d Abs. 2 Nr. 3 Hs. 3 RStV, im Auftrag der Konferenz der Gremienvorsitzenden der ARD, Juli 2010
Pariser, Eli (2011) The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You, Penguin Press New York
Portisch, Hugo, Über das “Rundfunk-Volksbegehren”, in: medien&zeit. Kommunikation in Geschichte und Gegenwart, Heft 3/1999, S. 48-56
Puttnam, David (2006) Lord Puttnam of Queensgate, CBE, The Creative Archive, speech delivered at Channel 4, 13.09.2006
PWC (2013) BBC Digital Media Initiative. Review of the BBC’s management of DMI, 17.12.2013
Ramsey, Phil (2013). The search for a civic commons online: an assessment of existing BBC Online policy. Media, Culture & Society. 35 (7), 864–879.
Ramsey, Phil (2015) The Engage programme and the Government Communication Network in the UK, 2006–2010. Journal of Public Affairs, 15 (4). pp. 377-386.
Ramsey, Phil (2016) ‘It could redefine public service broadcasting in the digital age’: assessing the BBC’s proposals for moving BBC Three online, in: Convergence.
Rogers, Tom (2003) The BBC’s development of open access multi-media Learning Centres and Buses, Research for the Lifelong Learning Foundation, Research Centra for the Learning Society, University of Exeter, November 2003
Schmidt, Jan-Hinrik; Lisa Merten, Uwe Hasebrink, Isabelle Petrich, Amelie Rolfs (2017) Zur Relevanz von Online-Intermediären für die Meinungsbildung, Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 40, März 2017 (Anhang)
Stark, Birgit (2017) Gefangen in der Echokammer? Politische Meinungsbildung auf Facebook, vorgetragen auf Veranstaltung zur politischen Meinungsbildung in sozialen Netzwerken, Berlin 08.03.2017
Starruß, Isabelle (2017) Analyse der informatischen Bildung an allgemein bildenden Schulen auf der Basis der im Jahr 2010 gültigen Lehrpläne und Richtlinien, Bakkalaureatsarbeit an der Technischen Universität Dresden, Stand: 14.02.2017
Steinmauerer, Thomas & Corinna Wenzel (2015) Public Network Value, Studie im Auftrag von ORF und BR
Stolte, Dieter (1980) Der Programmauftrag des Rundfunks, in: Stimmen der Zeit, Februar 1980
Unterberger, Klaus; Konrad Mitschka (2013), Medienqualität 2050, in: Rat für Forschung und Technologieentwicklung (Hrsg.), Österreich 2050. Fit für die Zukunft, Holzhausen Verlag Wien 2013, S. 246-250
Waldrop, M. Mitchell (1994) Culture Shock on the Networks, in: Science, 265. Jg., 12. August, 879-881, 12. August 1994
Wenzel, Corinna (2012) Selbstorganisation und Public Value: Externe Regulierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Springer-Verlag
Willnat, Lars; David H. Weaver (2014) The American Journalist in the digital Age: Key Findings, Bloomington, School of Journalism, Indiana University
Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages (2006) Der Kultur- und Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanstalten (WD 10 – 051/06), 2006
Wolf, Fritz (2013), Im öffentlichen Auftrag – Selbstverständnis der Rundfunkgremien, politische Praxis und Reformvorschläge, Otto Brenner Stiftung
Wolf, Fritz (2015) “Wir sind das Publikum!” Autoritätsverlust der Medien und Zwang zum Dialog, Otto Brenner Stiftung
Zapp, NDR-Medienmagazin (2017) Kritische Sicht: US-Journalisten und Trump, 15.03.2017, verfügbar bis 15.03.2018.
Zick, Andreas; Beate Küpper, Daniela Krause (2016) Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2016, Dietz Verlag Bonn
Fußnoten
1 Die Bundesregierung sieht das anders: „Die Rundfunkgebühren würden von den Besitzern von Radio- und Fernsehgeräten direkt an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gezahlt, so dass der staatliche Haushalt nicht tangiert würde. Des Weiteren unterstünden die Rundfunkgebühren weder der Kontrolle durch den Staat noch könne er auf sie zugreifen.“ (EU Kom. 2007: Rnd.nr. 82)
2 Z. B. Veranstaltung der Medienanstalten zur politischen Meinungsbildung in sozialen Netzwerken am 08.03.2017 in Berlin.
3 Wobei die BBC selbst einem anderen die Autorschaft für die Trias zuweist: „People often think that John Reith invented the triad of ‘inform, educate, entertain’. But the credit should go to David Sarnoff, the founder of American commercial radio, who wrote that its function was ‘entertaining, informing and educating the nation.’ Reith can take credit only for re-ordering the three and, characteristically, turning them into imperatives.“ (BBC September 2015).
4 Neben den genannten PVT alle Angebote regelmäßig einem „Service Review“ unterzogen, der alle Elemente eines PVT umfasst, beginnend mit dem Review of bbc.co.uk 2008.
5 Für die Umgehung dieser Beschränkungen mit Hilfe eines VPN gibt es Anleitungen, z. B. MacWorld 15.12.2016.
6 Hier die vollständige erste Sendung am 23.09.1998 auf Youtube.
7 S. 70 f. Offenlegung: ich war einer der befragten Experten.