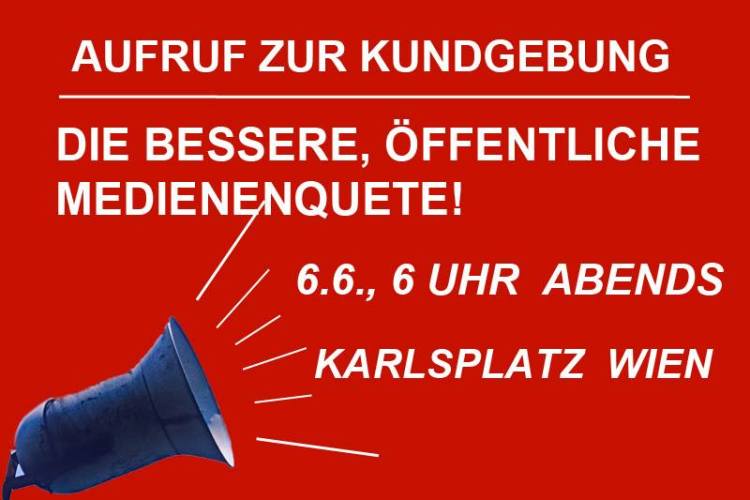Zu Auftrag und Mehrwert, Digitalisierung und Finanzierung
Am 6. und 7. Juni fand in Österreich eine parlamentarische Medienenquete statt. Zu drei Fragestellungen bat das Bundeskanzleramt um Eingaben. Hier meine leicht aktualisierte Stellungnahme.
Fragestellung 1: Öffentlich-rechtlicher Auftrag und „Public Value“
Wie sollte der öffentlich-rechtliche Auftrag und der gesellschaftliche Mehrwert, den dieser Auftrag gewährleisten soll, in einer zunehmend digitalisierten Welt abgegrenzt, definiert und weiterentwickelt werden?
Der grundsätzliche Auftrag öffentlich-rechtlicher Medien (ÖRM) bleibt bestehen. Die Formen seiner Erfüllung müssen sich dem Medienwandel anpassen.
Die ÖRM haben die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft zu erfüllen und den Pluralismus in den Medien zu wahren (EU-Recht). Sie haben allgemein zugängliche Quellen für zuverlässige Information und vielfältige Meinungen anzubieten, aus denen sich jeder ungehindert unterrichten und eine Meinung bilden kann (Verfassungsrecht). Sie sollen einen umfassenden Überblick über das Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen geben und die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Sie haben Bildung, Information, Beratung, Unterhaltung und Kultur zu dienen. Ihre Berichterstattung soll objektiv und unparteilich, meinungsvielfältig und ausgewogen sein (Rundfunkrecht).
Telemedienauftrag
Der tiefgreifendste Medienwandel unserer Zeit geht ohne Frage von der Digitalisierung aus. Im Internet sind weitere Aufträge hinzugekommen. Hier sollen die ÖRM allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglichen, Orientierungshilfe bieten sowie die technische und inhaltliche Medienkompetenz aller Generationen und von Minderheiten fördern.
Mit zunehmender Nutzungsintensität trägt das Internet immer stärker zu Meinungsbildung bei. Ein Viertel der Unter-40-Jährigen informiert sich heute bereits primär im Netz (Decker et al. 2017). Wenn die ÖRM relevant bleiben und weiterhin die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllen sollen, ist ihr Weg ins Internet somit unerlässlich. Die heutigen Beschränkungen der öffentlich-rechtlichen Online-Aktivitäten wie Sendungsbezug, kurze Verweildauern und Verbot von Presseähnlichem verhindern diesen Schritt.
Die Aktualisierung des Telemedienauftrags stand seit Jahren an. Mit dem auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 14. Juni beschlossenen Entwurf des 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrages sind Schritte eingeleitet, die ÖRM mit einem zeitgemäßen Online-Auftrag auszustatten. Die Depublizierungsfristen werden flexibilisiert und sollen von den Anforderungen des jeweiligen Angebots abhängen und, wie bislang, auch unbefristete zeit- und kulturgeschichtliche Archive umfassen. ÖRM dürfen Drittplattformen wie Social Media nutzen. Sie dürfen nun europäische Lizenzware wie Spielfilme und Serien online anbieten. Diese Regeln sind für Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF, bereits erfolgreich eingeführt und werden nun generalisiert. Außerdem werden die ÖRM beauftragt, ihre Online-Angebote miteinander zu vernetzen und auf Inhalte von Einrichtungen der Wissenschaft und Kultur zu verlinken. Eigentlich sollte auch die aus dem Internet gesehen irrelevante Unterscheidung zwischen sendungsbezogenen und nichtsendungsbezogenen Telemedien aufgegeben werden. Zwar werden originär für das Internet produzierte Inhalte zulässig, doch der „Sendungsbezug“ bleibt für die Regelung zur Presseähnlichkeit bestehen.
Der Streit der Verleger gegen öffentliche-rechtliche Texte im Netz hatte den neuen Telemedien-Staatsvertrag verzögert. Er geht zurück bis auf die Jahrtausendwende, als sich Verleger und kommerzielle Rundfunkveranstalter bei der EU-Kommission wegen vermeintlichen Beihilfeverstoßes der ÖRM durch ihre Internet-Angebote beschwerten. Ergebnis war ein dreistufiger Test, dem alle neuen ÖRM-Angebote unterzogen werden müssen. Dass dabei auch deren Marktauswirkung, also gerade nicht ihr Public Value, sondern ihr möglicher kommerzieller Schaden getestet werden muss – für jeweils mehrere Hunderttausend Euro Beitragsgelder – verkennt die kategoriale Verschiedenheit der beiden Eigenrationalitäten. Der deutsche Gesetzgeber hat über den EU-Beihilfekompromiss hinaus den ÖRM auch noch alles nach Gestaltung und Inhalt „Presseähnliche“ ohne Sendungsbezug verboten. Als Folge mussten ARD und ZDF ab 2009 den überwiegenden Teil ihrer Online-Inhalte ‘depublizieren‘. Trotz dieser Eindämmung hat die Presse keinen wirtschaftlichen Durchbruch erlebt.
Und sie hat nicht verhindert, dass acht Zeitungsverlage seit 2011 wegen vermeintlicher Presseähnlichkeit gegen die Tagesschau-App klagen, genauer: gegen das Angebot in der App am 15. Juni 2011. In einem ersten Urteil im Dezember 2013 befand das OLG Köln die Tagesschau-App für zulässig. Der BGH hob das Urteil im April 2015 auf – zum Schutz der Presse dürfe das Angebot nicht textdominiert sein, sondern müsse seinen Schwerpunkt in einer hörfunk- oder fernsehähnlichen Gestaltung haben – und verwies es zur Neuverhandlung an das OLG Köln zurück. In seinem zweiten Urteil im September 2016 entschied das Gerichtzugunsten der Verleger. Es erkannte die App in der Form, in der sie am zu prüfenden Tag vorlag, für presseähnlich. Da sich das Angebot der ARD seither verändert hat und mehr Video- und Audio-Informationen enthält, hatte das Urteil keine unmittelbaren Folgen. Gegen das OLG-Urteil legte der NDR Rechtsmittel ein, die der BGH im Dezember 2017 abgewiesen hat. Daraufhin reichte der NDR im Januar 2018 Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Noch ist offen, ob das oberste Gericht die Verfassungsbeschwerde annimmt.
Der Nachweis, dass Online-Texte der ÖRM das Geschäft der Verleger behindern würden, ist bislang nicht erbracht. Auch die Hoffnung, dass Menschen, die sich aufgrund von Inhalteverboten von den ÖRM abwenden, zu den Angeboten deutscher Verlage wechseln und nicht vielmehr zu denen von US-amerikanischen Internet-Plattformen, müsste sich noch bewahrheiten.
Inzwischen kam es in der Frage zu einer Einigung zwischen ÖRM und Presseverlagen. Vorangegangen war eine Online-Konsultation zur Aktualisierung des Telemedienauftrags im Juni 2017, auf die hin 62 Stellungnahmen eingingen. Leonhard Dobusch hat sie ausgewertet (Netzpolitik 18.07.2017). Darunter hatte allein der BDZV in seiner Stellungnahme ein grundsätzliches Verbot öffentlich-rechtlicher presseähnlicher Telemedienangebote gefordert. Die Mehrzahl der Einlassungen zum Thema fordern hingegen eine Lockerung oder völlige Abschaffung des Verbotes. ZDF und WDR hatten vorauseilend das Textangebot in ihren Mediatheken bereits auf jeweils wenige Zeilen reduziert.
Und dann setzte sich in der ersten Juni-Woche Mathias Döpfner, Vorsitzender des Zeitungsverlegerverbandes BDZV, als Verhandlungsführer der Verleger mit den Intendanten Thomas Bellut vom ZDF, Stefan Raue vom Deutschlandradio und als Vertreterin des ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm der MDR-Intendantin Karola Wille zusammen. Ergebnis des Deals ist eine Aufgabenteilung: Die Online-Angebote der ÖRM sollen „von ihrer Anmutung her“ den Schwerpunkt auf Audiovisuelles setzen, also auf den ersten Blick als „Mediathek“ zu erkennen sein. Die Zeitungsanmutung soll den Verlagen überlassen bleiben. Um künftige Konfliktfälle über die Anmutungsregel zunächst vorgerichtlich zu lösen, wird eine gemeinsame, paritätisch besetzte Schiedsstelle eingerichtet – eine Idee des Deutschlandradio-Intendant Raue (Horizont 10.06.2018).
Das Einigungsmodell zwischen ÖRM und BDZV hat die Politik nun am Stück in den neuen Staatsvertrag übernommen. Diese Beschränkung der öffentlich-rechtlichen Online-Aktivitäten erscheint nun als Kern des neuen Staatsvertrages. Die Generalisierung der bei Funk erprobten Freiheiten wird dagegen als Gegenleistung für das Entgegenkommen an die Presseverlage dargestellt (Meedia 15.06.2018).
Daniel Bouhs sieht darin auf Zapp (14.06.2018) „eine bislang einmalige Form der Medienpolitik“: Erst setzen sich die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender mit Vertretern der Verlage zusammen und dann nickt die Politik die ausgehandelten Spielregeln ab. Der nun vereinbarte Kompromiss ist gar keiner, sondern eine Kapitulation vor den Verlegern, schrieb ZDF-Fernsehrat Leonhard Dobusch auf Netzpolitik (17.06.2018) und führte acht gute Gründen für mehr öffentlich-rechtliche Texte an. Heiko Hilker, Mitglied des MDR-Rundfunkrats, kritisierte im Deutschlandfunk (18.06.18), dass die Verleger in der Schlichtungsstelle mitentscheiden sollen, wie viel Text ein Sender online stellen darf. Das sei Hoheit der Gremien. Die Medienpolitik scheine dem Druck der Verleger erlegen zu sein und in diesem Bereich ihre Hoheit aufgegeben zu haben. Die grüne Medienpolitikerin Tabea Rößner hält den Verleger-Deal für verfassungswidrig. Die Vorgaben, wie die Angebote inhaltlich und formal zu gestalten sind (nämlich Bewegtbild oder Ton), würden in den Kern der Programmautonomie der Sender eingreifen, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zentraler Bestandteil der Rundfunkfreiheit ist. Stattdessen fordert sie in der Medienpolitik (18.06.18) erneut eine breite Diskussion darüber, was die ÖRM für die Gesellschaft tun sollen. Der Anstoß dazu solle von einer Expertenkommission kommen.
Über den von den Länderchefs beschlossenen Entwurf des 22. Rundfunkstaatsvertrages werden nun die Landesparlamente vorunterrichtet. Unterzeichnet werden soll er auf der Jahreskonferenz der Ministerpräsidenten der Länder im Oktober. Es folgen seine Verabschiedung durch die 16 Landesparlamente und sein Inkrafttreten zum Januar 2019.
Der finale Wortlaut bleibt abzuwarten. Ebenso, wie lange der Burgfrieden mit den Verlegern hält. Zu hoffen ist, dass eine erneute Massen-Depublizierung wie 2010 verhindert werden kann und die neue Textregel, wenn überhaupt, nicht rückwirkend, sondern erst ab Inkrafttreten des Staatsvertrages für alles neu Veröffentlichte gilt. Auch die Befürchtungen, dass Blogs wie Altpapier beim MDR oder Digitalistan vom WDR dem Verleger-Deal zum Opfer fallen könnten, sollten schnell ausgeräumt werden.
Außerdem sind bei einer Regel auf derart dürftiger Faktenbasis weitere Sicherungen wie ein Verfallsdatum angebracht: Nach zwei Jahren ist sie zu evaluieren. Können die Zeitungsverlage dann immer noch keinen empirischen Nachweis erbringen, dass Textangebote der ÖRM maßgebliche Ursache dafür sind, dass ihre kommerziellen Online-Angebote scheitern, verfällt die Beschränkung automatisch. Bis dahin liegt möglicherweise auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vor. Von ihm ist zu erwarten, dass es seine Argumentation zur Entwicklungsoffenheit des öffentlich-rechtlichen Auftrags fortschreiben und nicht nur ein Recht, sondern die Verpflichtung der ÖRM anmahnen wird, Internet-adäquate Gestaltungs-, Präsentations- und Interaktionsformen einschließlich Text zu entwickeln, um seinen Verfassungsauftrag weiterhin erfüllen zu können.
Gesellschaftlicher Mehrwert
Der gesellschaftliche Mehrwert der ÖRM ist das, was über den individuellen Konsumentennutzen hinausgeht. Diesen Public Value definieren die Ökonomen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) als „positive externe Effekte“. In einer Studie 2017 im Auftrag der ARD erläutern sie: „Damit ist gemeint, dass die Gesellschaft als Ganzes davon profitiert, wenn bestimmte Rundfunkinhalte von einer großen Anzahl von Personen gesehen, gelesen oder gehört werden. Der Rundfunk kommt also nicht nur dem konkreten, einzelnen Rezipienten zugute, sondern auch unbeteiligten Dritten.“ Zu diesen Effekten gehören die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Bildung, aktuelle Berichterstattung und politische Hintergrundberichte, die zum politischem Bewusstsein und Engagement beitragen, und Beiträge zur nationalen, regionalen und kulturellen Identität. „Auch programmatischer Vielfalt und Regionalität werden positive Effekte zugesprochen. Zudem werden positive Netzwerkeffekte genannt, die entstehen, wenn Gespräche im Umfeld von und über populäre Medienereignisse soziale Interaktion fördern“ – das „Fernseh-Lagerfeuer“.
Dass diese Effekte tatsächlich eintreten, belegen die Forscher mit empirischen Studien zur Verbesserung von politischem Kenntnisstand und Interesse durch Nutzung von ÖRM sowie deren Wahrnehmung als gemeinwohlfördernd. Auch eine Untersuchung der EBU zeigt, dass sich in Ländern mit starken ÖRM ein höherer Grad an Pressefreiheit, eine höhere Wahlbeteiligung, ein niedrigerer Grad an Rechtsextremismus und eine bessere Korruptionskontrolle finden (EBU Juni 2016).
Ökonomische Standardtheorie besage nun, so die DIW-Forscher, dass externe Effekte auf unbeteiligte Dritte typischerweise weder von Produzenten noch von Konsumenten bei wirtschaftlichen Entscheidungen berücksichtigt werden. Angebot und Nachfrage werden daher Güter mit positiven externen Effekten in zu geringer Menge bereitstellen. Das gelte auch für Rundfunkinhalten mit Public Value. Kommerzielle Medienanbieter werden sich auf profitable Inhalte richten, die dem individuellen Konsumnutzen dienen. Selbst wenn einige Konsumenten sich anderes wünschen, nehmen sie durch ihre individuelle Entscheidung nur marginal Einfluss auf die Medienlandschaft. „Ergebnis ist, dass sich die Anreize von gewinnorientierten, privatwirtschaftlichen Akteuren nicht am gesamtgesellschaftlichen Optimum orientieren. “
Die beste Lösung für dieses Versagen des Medienmarktes sehen die DIW-Ökonomen in langfristig angelegten, öffentlichen Institutionen mit strikter Gemeinwohlorientierung und langfristig gesicherter Finanzierung. Anders als Marktakteure seien ÖRM in der Lage die Bereitstellung von Public-Value-Inhalten mit ausreichender Reichweite auch im Internet zu gewährleisten (DIW, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in einer konvergenten Medienwelt, Februar 2017).
Auch die Gefahrenlagen öffentlich beauftragter und finanzierter Medien und damit ihre Abgrenzungen ändern sich durch den Medienwandel nicht. Sie sind weiterhin gegen die Einflussnahmen von Staat und Markt zu schützen. Der historische Auftrag an Gesellschaft und Gesetzgeber lautet sicherzustellen, dass mediale Meinungsmacht nicht für Propaganda und Gleichschaltung missbraucht werden kann. Der aktuelle Auftrag lautet, nicht den Forderungen der Unternehmen nachzugeben, die ÖRM zu beschneiden, insbesondere ihnen die Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrags im Internet zu verwehren. Damit würde den kommerziellen Medien nicht geholfen und der Demokratie ein Bärendienst erwiesen.
Fragestellung 2: Finanzierung und Förderung
Der österreichische Medienmarkt steht vor großen Herausforderungen: Es ist ein kleiner Markt, der aufgrund der gemeinsamen Sprache eng mit dem zehnmal so großen deutschen Markt verknüpft ist. Wie soll und kann zukunftsfähige Medienfinanzierung aussehen?
„Der Auftrag bestimmt den Beitrag und nicht umgekehrt.“ (Zehn Thesen zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien). Die Gesellschaft entscheidet, welche Leistungen sie von ihren ÖRM erwartet. Die Kosten dafür hat die Gesellschaft zu tragen. Wer die Musik bezahlt, bestimmt die Melodie. Das gilt für den Konsumenten im Ballhaus, im Supermarkt und bei Netflix. Wer gefühlt kostenlose Dienste nutzt, ist selbst das Produkt, das an Werbetreibende verkauft wird – wie der Facebook-Skandal erneut deutlich gemacht hat. Beauftragt die Gesellschaft eine mediale Selbstbeobachtung im öffentlichen Interesse, muss sie folglich selbst dafür bezahlen.
zwei verschiedenen Eigenrationalitäten
Diese informationelle Versorgung unterscheidet sich grundsätzlich von kommerziellen medialen Angeboten. Das deutsche Bundesverfassungsgericht spricht von zwei verschiedenen „Eigenrationalitäten“: Kommerzielle Rundfunkanbieter handeln nach marktwirtschaftlichen Anreizen und zielen auf Profitmaximierung. Sie werden daher bevorzugt ein massentaugliches Programm anbieten, um Aufmerksamkeit für Werbung und Abos zu generieren, nicht aber Nischenprogramme. Zudem stünden sie unter erheblichem Konzentrationsdruck, der die Gefahr einer einseitigen Einflussnahme auf die Meinungsbildung verstärkt. Die verfassungsrechtlich gebotene inhaltliche Vielfalt könne allein über den freien Markt nicht gewährleistet werden.
Demgegenüber sind die ÖRM öffentlich beauftragt und finanziert. Ihre „Eigenrationalität“, so das Gericht, besteht darin, ihr Programm unabhängig von Erlösdruck und Quote zu gestalten und ihren Auftrag, der Meinungsbildung umfassend zu dienen, für das gesamte Publikum zu erfüllen. Um ihren Auftrag auch künftig erfüllen zu können muss das Angebot der ÖRM für neue Publikumsinteressen und neue technische Entwicklungen offen sein. Schließlich weist das Gericht darauf hin, dass im Nebeneinander die beiden verschiedenen Entscheidungsrationalitäten aufeinander einwirken können (BVerfG, ZDF-Urteil, März 2014).
Beide Systeme bergen ihre spezifischen Gefahrenlagen: Bei den ÖRM ist das die Einflussnahme von Staat und Markt, bei Medienunternehmen das Marktversagen, das zu einer Unterversorgung mit gesellschaftlich gewünschten Public Value Inhalten führt. Die Antworten auf diese Gefahren müssen die jeweilige Eigenrationalität berücksichtigen.
So ist klar, dass der Vorschlag, ÖRM statt durch eine separate Abgabe aus dem Staatshaushalt zu finanzieren, die Gefahr staatlicher Einflussnahme erheblich steigern würde. Er würde die ÖRM an der entscheidenden Stelle unter unmittelbare politische Kontrolle stellen, am Geldhahn. Ihre Arbeitsgrundlage hinge dann von den aktuellen politischen Mehrheitsverhältnissen und Prioritäten bei der Aushandlung des Haushaltsgesetzes ab. Umgekehrt würden Vorschläge für Public-Private-Partnerships (PPP) oder Gebührensplitting die Gefahr der Einflussnahme durch den Markt erhöhen.
Neben ÖRM-Institutionen diskutierten die DIW-Forscher in ihrer Studie 2017 als Lösung für das Marktversagen auch die Bereitstellung von Public-Value-Inhalten durch Auflagen und durch Ausschreibungen. Public-Value-Auflagen im Gegenzug für staatliche Privilegien, etwa Zugang zu Frequenzen und Sendeplätzen oder finanzielle Zuschüsse, gibt es in vielen Ländern, darunter in
Deutschland und Österreich. Da kommerzielle Anbieter Anreize haben, geforderte Nachrichten oder Kultursendungen nur in Randzeiten zu senden, um die Primetime für populäre, kommerzielle Inhalte zu reservieren, und zudem im Internet das Instrument der Frequenzvergabe wegfällt, halten die Autoren das Auflagenmodell nicht für eine langfristige Lösung.
Gebührensplitting
Die Idee von Ausschreibungen durch ein „Gebührensplitting“ (Top-Slicing) ist seit der Jahrtausendwende in UK von Wirtschaftswissenschaftlern und der Regulierungsbehörde Ofcom lanciert wurde. Ein Teil der BBC-Beitragsgelder soll in einen Fonds gehen, der Public-Value-Inhalte ausschreibt, die dann auf kommerziellen Plattformen kostenlos veröffentlicht werden. Nach einer Konsultation plant die UK-Regierung nun ein Pilotprojekt für einen solchen „Contestable Fund“, das Ende 2018 starten und über drei Jahre 60 Mio. Pfund ausschütten soll, die in der letzten Beitragsperiode für den Breitbandausbau vorgesehen, aber nicht ausgegeben worden waren. Geförderte Produktionen sollen Kriterien wie Qualität, Innovation, Vielfalt und „Additionalität“ erfüllen. Thematisch soll der Schwerpunkt zunächst auf Inhalten für Kinder liegen, die von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sind und sich aufgrund von Werbebeschränkungen nur schwer am Markt finanzieren lassen.
Ein ähnliches Modell wird in der Schweiz und in Irland bereits seit einigen Jahren praktiziert. In beiden Ländern wurde der Anteil des im Wettbewerb vergebenen öffentlichen Geldes immer weiter erhöht. Vorreiter des Ausschreibungsmodells ist Neuseeland. In einer Fallstudie zeigen die Ökonomen vom DIW sein vollständiges Scheitern. Die wichtigste Hoffnung dabei, Kosteneffizienz durch den Wettbewerb konkurrierender Anbieter um einen öffentlichen Auftrag, habe sich nicht erfüllt. 1989 wurde der staatlichen Fernsehanstalt Television New Zealand (TVNZ) der öffentliche Programmauftrag und die direkte staatliche Förderung entzogen. Seither finanziert sich sich TVNZ zu 95% aus Werbung und hat den Auftrag Gewinne zu maximieren und Dividenden an den Staat auszuschütten. Im selben Jahr wurde die Stiftung New Zealand On Air (NZOA) gegründet, die mit öffentlichen Mitteln das Angebot an Public-Value-Inhalten sicherstellen soll. Sender, Produzenten und Künstler können sich initiativ oder auf Ausschreibungen der NZOA bewerben. Schwerpunkte der Förderung liegen auf lokalen Inhalten und Informationen sowie auf Sendungen für Kinder und junge Leute. Bewerber müssen vorab Zusagen von kommerziellen Anbietern beibringen, dass die geförderten Inhalte im frei empfangbaren Fernsehen, Radio oder über Telemedien zugänglich gemacht werden.
Genau darin liegt nach Analyse des DIW das Problem: Public Value Inhalte sind oft nicht mit der Marken- und Senderstrategie kommerzieller Anbieter kompatibel. Einzelne solcher Inhalte seien Fremdkörper im ansonsten kommerziellen Programm. Selbst wenn die Inhalte subventioniert sind, haben kommerzielle Sender kein Interesse an der Ausstrahlung, wenn sie eine niedrige Reichweite erwarten. Zudem würden gewinnorientierte Sender Kosten reduzieren, auch wenn dies zulasten der Qualität geht, und hätten Anreize, die Berichterstattung zugunsten kommerzieller Interessen zu verzerren. Um die Versorgung mit Public-Value-Inhalte zu gewährleisten, entschied die Labour-Regierung, 2007 den Kinder- und Jugend-Kanal TVNZ 6 und 2008 den Spartenkanal TVNZ 7 für Nachrichten, Information und Kultur mit staatlicher Förderung durch das Ministry for Culture and Heritage zu starten. Die nachfolgende konservative Regierung strich 2011 die Förderung zusammen, woraufhin beide Public Value Stationen ihren Betrieb einstellen mussten. Fazit der DIW-Forscher: Das neuseeländische Experiment mache deutlich, dass die rein marktbasierte Bereitstellung gesellschaftlich wünschenswerter Public-Value-Inhalte nicht funktioniert. Betriebswirtschaftlich ist die Bereitstellung derartiger Inhalte nicht profitabel, daran ändern auch öffentliche Ausschreibungen nichts. Daher folgern die DIW-Ökonomen, dass einzig ÖRM-Institutionen geeignet sind, eine Public-Value-Versorgung sicherzustellen.
Mit dem Gebührensplitting würde sich die öffentliche Finanzierung hin zur Produktion von einzelnen Grundversorgungsinhalten und weg von den ÖRM-Institutionen verschieben, die sie bisher bereitgestellt haben. Im Wettbewerb um öffentliche Mittel würden ÖRM ausgehöhlt. Ihr Ende wäre damit vorgezeichnet. Grundversorgung ist nach dem deutschen Bundesverfassungsgericht aber keine Liste einzelner Versatzstücke, sondern eine Vielfalt und Ausgewogenheit, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Rahmen zu gewährleisten sind. Was bliebe, wenn es die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht mehr gäbe, ist eine öffentlich geförderte Produktion von Lückenfüllern, die auf kommerziellen Plattformen präsentiert werden, die als Rundfunk minimale Public Value-Anforderungen haben und im Internet gar keine.
Irrglaube an die Privatisierung
Das ist wohl das Verblüffendste an der Debatte: Wie kann nach fast 40 Jahren Irrglaube an die Privatisierung das neoliberale Dogma, der Markt sei die beste Lösung für alles, weiterhin eine derartig umfassende Hegemonie besitzen – nicht nur im politischen, sondern auch im populären Diskurs? Freier Markt und minimaler Staat, Privatisierung und Deregulierung. Alles Öffentliche ist bürokratisch, ineffizient, paternalistisch bevormundend, an den Bedürfnissen der Menschen vorbei, korruptionsanfällig. Der Markt kann das besser. Von Ökonomen an der Universität Chicago um Milton Friedman erdacht, von deren Schülern, den „Chicago Boys“ in Chile unter Diktator Pinochet wie in einer Petrischale in Reinform getestet und dann seit Beginn der 1980er von Thatcher, Kohl und Reagan großflächig ausgerollt und fortgesetzt in den 1990ern durch die Sozialdemokraten Blair, Schröder und Clinton trat der Marktradikalismus seinen Siegeszug an. Dienste der Daseinsvorsorge und öffentliche Güter wurden nun bevorzugt von Unternehmen im Auftrag von Staat bereitgestellt.
Schon 2003 gemahnten Forscher um Ernst Ulrich von Weizsäcker in ihrem Bericht an den Club of Rome an die „Grenzen der Privatisierung“ (dt. 2006). Das Privatization Barometer markiert in seinem Report 2015/2016 den Höhepunkt: 2015 nahmen Staaten weltweit den Rekordbetrag von 290 Mrd. Euro durch Privatisierungen ein. 2016 sanken diese Einnahmen auf 241 Mrd. Euro. Inzwischen schwingt das Pendel in den hochentwickelten Ländern zurück. 2013 kaufte das Land Berlin die teilprivatisierten Wasserbetriebe zurück, nachdem sich die Hauptstädter in einem Volksentscheid zu 98,2 Prozent dafür ausgesprochen hatten. Dieser Trend zur Rekommunalisierung zeigt sich in vielen Städten und Feldern der Daseinsvorsorge: bei Abfallentsorgung, Strom, Gas und öffentliche Immobilien und Liegenschaften. Was seit den 1990ern billig abgegeben wurde, muss jetzt teuer und unter europäischen Vergabebedingungen zurückgekauft werden.
Im Hörfunk konnte gerade eine Privatisierungs-Katastrophe abgewendet werden. Für Rundfunkübertragungstechnik wie die UKW-Antennen war bis zu ihrer Privatisierung die Bundespost zuständig. Dann übernahm die Telekom-Tochter Media Broadcast GmbH die Sendeanlagen als alleiniger Dienstleister. Durch die Novelle des Telekommunikationsgesetzes von 2012 ist zum Januar 2016 dieses Monopol beendet worden. Radiosender können sich nun einen Sendernetzbetreiber wählen. Als Wettwerber zu Media Broadcast sind u.a. Divicon Media, Uplink Network und Sendernetzbetrieb Baden-Württemberg (SBW), ein Gemeinschaftsunternehmen mehrerer regionaler Privatradios, hinzu gekommen. Media Broadcast wurde im März 2016 vom Mobilfunkkonzern Freenet übernommen. Nachdem die Bundesnetzagentur Media Broadcast die angekündigten Preise für ihre Dienstleistungen nicht genehmigte, gab das Unternehmen im Februar 2017 bekannt, alle UKW-Antennen verkaufen zu wollen. Die Auktion fand im November und Dezember 2017 statt. Das Gros der rund 700 Sendeanlagen ging an fünf Finanzinvestoren, die bisher nicht auf dem Radiomarkt aktiv waren. Die erhöhten umgehend die Preise um etwa 30 Prozent. Einer der Investoren drohte, wenn die Bundesnetzagentur die Preise regulieren würde, wolle er seine 208 Antennen einfach abbauen.
Mehr als 80 Prozent der Radiohörer empfangen ihre Programme über UKW. Rund 40 öffentlich-rechtliche und private Sender verbreiten Programme über die UKW-Antennen. Für viele kleinere Radiostationen hätte die Preiserhöhung das Aus bedeutet. Bei einem Krisengipfel aller Beteiligter Mitte März konnte zunächst eine UKW-Abschaltung verhindert werden. Media Broadcast erhält den Betrieb bis Ende Juni aufrecht. Die Bundesnetzagentur schaltete sich ein. Die Rundfunkkommission der Länder erwägt, eine gesetzliche Verpflichtung zum UKW-Betrieb zu erlassen. Medienstaatssekretärin Heike Raab des Vorsitzlandes Rheinland-Pfalz hob hervor, dass das Radio kein beliebiges Wirtschaftsgut sei. „Es hat eine große Bedeutung und wird noch von vielen Menschen als Informationsquelle geschätzt.“
Bayern löste das Problem im Alleingang, indem es Anfang Juni über seine Landesmedienzentrale alle 180 UKW-Sendeanlagen in dem Bundesland zurückkaufte. Im übrigen Land gab es in der vergangenen Woche eine Einigung. Die Bundesnetzagentur hatte den ehemaligen Kanzleramtschef Friedrich Bohl als Schlichter eingesetzt. Dem gelang eine Einigung zwischen den Streitparteien, über die diese jedoch Stillschweigen halten. Nach Informationen der taz (20.06.2018) besteht sie in Zugeständnissen zu gleichen Teilen: Die Radiosender zahlen etwas mehr, die Antennenbesitzer verlangen etwas weniger und die Sendernetzbetreiber senken ihre Gewinnmarge etwas.
Damit ist ein katastrophales Marktversagen im letzten Moment abgewendet worden – in Bayern kurzerhand durch Wiederverstaatlichung. Verblüffend bleibt, dass die regelmäßige Erfahrung, dass Privatisierung der Daseinsvorsorge ein Irrglaube ist, vor der regelmäßigen Wiederholung dieses Irrglaubens an den Marktradikalismus nicht schützt. Dieselben Fehler werden bei der informationellen Daseinsvorsorge wiederholt, wenn die ÖRM durch eine Salamitaktik von Online-Beschränkungen im Interesse des Marktes, Gebührensplitting und öffentlich-private Partnerschaften marktgängig gemacht werden sollen.
Public Private-Partnership im Internet
Besonders intensiv wird derzeit eine Public Private-Partnership (PPP) der europäischen Qualitätsmedien im Internet diskutiert. ÖRM, Presseverlage und kommerzielle Rundfunkanbieter sollen sich zusammen tun, um den US-amerikanischen Plattformen etwas entgegen zu setzen. In Deutschland spricht sich der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm für eine „Supermediathek“ aus. Er möchte nichts weniger als die europäischen Medien einen, um eine Emanzipation vom Silicon Valley zu erreichen. Auf der eigenen Plattform sollen die Daten sowie die Spielregeln unter Kontrolle bleiben und „öffentlich-rechtliche, aber auch viele andere Inhalte Platz finden“. Viele andere hat Wilhelm bislang jedoch nicht zur Kooperation eingeladen. Am wichtigsten ist ihm, die Zeitungsverleger ins Boot zu holen. Unter der Kategorie „Qualitätsjournalismus“ sollen die Unterschiede zwischen öffentlich beauftragt und kommerziell verwischt und die beiden Systeme zusammengeführt werden.
In Österreich trat unter anderen Markus Breitenecker, Chef der größten privaten Fernsehgruppe des Landes ProSiebenSat.1Puls 4 mit dem Vorschlag hervor, alle Medien Europas sollten sich zusammenzuschließen, um ein europäisches Facebook, Google oder YouTube zu entwickeln. Das Gebührengeld solle an alle verteilt werden, die Qualität liefern (Die Presse 02.06.2018).
Wie eine solche PPP-Plattform aussehen soll, ist noch unklar. Eine Plattform, auf der öffentlich beauftragte und bezahlte Inhalte frei zugänglich neben kommerziellen Inhalten mit Werbung versehen oder hinter einer Zahlschranke angeboten werden – beides ist den deutschen ÖRM untersagt – scheint schwer vorstellbar.
WDR-Intendant Tom Buhrow hat nun im journalist-Interview Wilhelms Idee einer gemeinsamen Internetplattform von Qualitätsmedien konkretisiert: „Meine Vision ist, dass wir alles, was wir im aktuellen Bereich audiovisuell haben, ohne Bezahlung auf die gemeinsame Plattform einstellen. Die Zeitungsverlage könnten dann unsere Angebote zu ihrem Text verlinken.“
Buhrow nannte ein Beispiel: „Die Verlage könnten sagen: Der Unfall auf der A3, hier ist das Video dazu, und auf dem Bildschirm steht WDR. Die Leute wissen dann, das ist von meinem Landessender.“ Wo die Zuschauer das WDR-Video am Ende sehen würden, ob beim WDR selbst, auf der gemeinsamen Plattform oder der Website des Verlags, sei letztlich zweitrangig, so Buhrow. „Vielleicht verlinken wir sogar zu Text von den Verlagen.“ Und weiter:„Dann hat die Zeitung ein attraktives Produkt mit einem starken Online-Auftritt, wir haben aber auch einen starken Online-Auftritt.“
Diese Vision wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Das WDR-Video soll also beim WDR (und ab Herbst in der neuen gemeinsamen ARD-Mediathek) zu sehen sein und auch – nicht verlinkt, wie an Buhrows Beispiel klar wird, sondern eingebettet – bei FAZ.de oder Welt.de. Aber welche Aufgabe hat dann die „gemeinsame Plattform“? Die erste Frage an Buhrow ist, welches Problem er mit seinem Vorschlag lösen möchte. Offenkundig geht es um die Befriedung des Streits mit den Verlegern über presseähnliche Inhalte der ÖRM. Dazu bietet er ihnen die kostenlose Nutzung öffentlich-rechtlicher Videos und vielleicht die – bezahlte? – Übernahme von Verlagstexten, die zum eigenen Video auf WDR.de gestellt werden oder vielleicht nur Schnipsel, deren Leistungsschutzrechte (Spiegel 01.06.2018) dann über die VG Media vergütet werden? Alle aktuellen audiovisuellen Beiträge stellen die ÖRM ohnehin in ihre Mediatheken. Um Verlagen zu erlauben, diese einzubetten, braucht es keine neue Plattform. Dürfen nur Presseverlage ÖRM-Videos einbetten oder auch die Wikipedia? Die kostenlose, weitgehende Nutzung auch für kommerzielle Zwecke käme der Standard Creative Commons-Lizenz der Wikipedia schon ziemlich nahe, aber der Teufel steckt wie immer im Detail. An welche Lizenzbedingungen denkt Buhrow genau? Sollen auch Veränderung, z.B. Remixe, erlaubt sein? Ist eine nachhaltige Bereitstellung gewährleistet oder steht nach einigen Wochen oder Monaten an der Stelle des eingebetteten Videos ein „404 – Seite nicht gefunden“? Wenn es um alles Audiovisuelle im aktuellen Bereich geht, hat Buhrow schon einmal überschlagen, mit welchen zusätzlichen Urhebervergütungen zu rechnen ist?
Die andere aktuelle Herausforderung, die Wilhelm und Buhrow scheinbar angehen, ist die problematische Erfahrung mit den Drittplattformen. Sie zeigt, dass es gerade nicht zweitrangig ist, wo Nutzer ein Video sehen. Youtube, Facebook, Snapchat etc. haben für die Meinungsbildung eine derartige Bedeutung angenommen, dass ÖRM in ganz Europa die Notwendigkeit sehen, ihre Inhalte dort zu verbreiten, um vor allem junge Menschen weiterhin zu erreichen. Gleichzeitig sind sie sehr unglücklich darüber, dass sie dort keine Kontrolle über den Kontext ihrer Inhalte haben, Änderungen der technischen Funktionen und der Vertragsbedingungen unterliegen, die es ihnen erschweren, ihre Anforderungen zu erfüllen, und dass sie dafür kritisiert werden, kommerzielle Plattformen zu subventionieren, denen die Endnutzer letztlich die ÖRM-Inhalte zuschreiben, deren Wiedererkennbarkeit dadurch verschwimmt.
Diese Probleme mit den US-Plattformen haben gerade den Wunsch nach einer starken, gemeinsamen, gemeinwohlorientierten Plattform ausgelöst. Wieder war es die BBC, die 2015 als erste ankündigte, ihre Internetplattform durch Kooperationen mit öffentlichen Wissens- und Kultureinrichtungen wie Museen und Universitäten zu stärken. Seither sprechen ÖRM in ganz Europa über Plattformen. Dörr/Holznagel/Picot (2016) griffen den Vorschlag für Deutschland auf, fügten dem Plattformmix NGOs und Nutzerbeteiligung hinzu und prägten den Begriff „Public Open Space“. Im aktuellen Facebook-Skandal hat dieser Wunsch nach alternativen Plattformen an Dringlichkeit zugenommen.
Buhrows Vorschlag zielt aber gerade nicht auf eine nicht-kommerzielle Plattformalternative, sondern darauf, ÖRM-Videos auf Presse-Sites stellen zu lassen. Das würde aber auf dieselben Probleme stoßen, wie auf den US-Plattformen: keine Kontrolle über das Umfeld, unangekündigte Änderungen von Features und AGB, Werbung und der Vorwurf, dass kommerzielle Angebote mit öffentlichen Beitragsgeldern subventioniert werden.
Um das Plattform-Problem zu lösen, ist die vorgeschlagene Partnerschaft mit Medienunternehmen somit untauglich. Umgekehrt braucht es, um die Verleger zu befrieden, keine gemeinsame Plattform.
Vor allem aber ist es gar nicht Aufgabe der von der Gesellschaft beauftragten ÖRM, Medienunternehmen Deals anzubieten, um deren Interessen zu befriedigen. Hier ist es an der Politik, den ÖRM den Rücken frei zu halten. Von den Intendanten, den Statthaltern der Interessen der Gesellschaft, würde man erwarten, dass sie sich der kategorialen Verschiedenheit öffentlich beauftragter und kommerzieller Medien bewußt sind und sie die ÖRM stärken und gegen staatliche wie marktliche Vereinnahmungen schützen.
Doch hier war es ausgerechnet der Vorsitzende des BDZV und Springer-Chef Döpfner, der an diese Verschiedenheit erinnerte. Auf den Vorschlag von Wilhelm und nun wortgleich auch auf den von Buhrow reagierte er zurückhaltend. Man wolle ihn prüfen. „Natürlich muss man immer sehr darauf achten, dass nicht ein Kooperationsangebot auch eine Umarmung wird, die das Gegenüber erdrückt und ihm die Luft abschnürt.“ Vor allem sei dabei „sehr darauf zu achten, dass privater Sektor und öffentlicher Sektor getrennt bleiben.“ (Deutschlandfunk 26.03.18 und Heise 01.06.2018).
eine vierfache öffentliche Partnerschaft im Netz
ÖRM und kommerzielle Medien sollen getrennt bleiben, sagt der Verlegerchef. Sie sind kategorial verschieden, sagt das Bundesverfassungsgericht. Kern der Eigenrationalität der ÖRM ist es, frei von staatlichen und marktwirtschaftlichen Einflüssen dem öffentlichen Interesse zu dienen. Darin haben sie durchaus Verbündete.
Denselben Zielen sind auch öffentliche Wissensinstitutionen verpflichtet. Tausende der von der BBC genannten Museen und Bibliotheken sind bereits in Europeana zusammengeschlossen. Dazu gehört auch die aktuelle Kultur- und Wissensproduktion in Hochschulen, Festivals, der Bundeszentrale für politische Bildung und anderen öffentlichen Einrichtungen. Dörr et al. nennen NGOs als weitere Plattform-Partner, ohne Beispiele zu geben. Doch was läge näher als die Wikipedia? Die freie Enzyklopädie ist die am fünft-häufigsten genutzte Internetsite und wichtige Quelle nicht nur für junge Menschen. Daneben engagieren sich weitere zivilgesellschaftliche Wissens-Allmendgemeinschaften wie Open Access Science, Freie Software und Open Educational Resources für qualitätsgesichertes, relevantes, quellengestütztes Wissen für das Gemeinwohl und mit freiem und universellem Zugang – ganz wie die ÖRM.
Die ÖRM dienen den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft. Ergo müssen die vierte Säule der Plattformpartnerschaft die Bürgerinnen und Bürger selbst sein, die sich mit Kommentaren und Empfehlungen, der Kuratierung und Produktion von Inhalten sowie in der Governance der Plattform beteiligen. Bürgerkanäle gehören ohnehin schon zum ÖRM. Ein nicht-kommerzielles Youtube wird immer wieder gefordert (Hündgen 2013). Erfolgreiche Beispiele sind ABC Open der Australian Broadcasting Corporation und die Videokurationsplattform Network Awesome. Nicht zuletzt ist Partizipation entscheidend für die gesellschaftliche Integration, indem sie Gemeinschaften wieder ins Gespräch bringt. Auch öffentliches und Allmendewissen sind kategorial verschieden, teilen jedoch fundamentale Werte und Orientierungen und unterscheiden sich in ihren Eigenrationalitäten klar von kommerziellen Medien, was sie zu natürlichen Verbündeten macht.
Anders als eine PPP birgt eine solche vierfache öffentliche Partnerschaft keine Gefahren für die demokratische Öffentlichkeit, da alle Beteiligte dem Public Value verpflichtet sind. Wenn alle vier Partner ihre Informations- und Kulturschätze, ihr Vertrauen, ihre Reputation und Reichweiten zusammen bringen würden, hätte sie eine Chance, eine starke, europäische Präsenz im Netz zu etablieren. Ein internationales Forschungs- und Entwicklungsprojekt namens European Public Open Spaces (EPOS) hat sich vorgenommen, einen solchen öffentlichen Freiraum in der digital vernetzten Öffentlichkeit zu entwerfen (mehr dazu unter https://publicopen.space).
Presseförderung
Die spezifische Gefahrenlagen im Medienmarkt ist ein Marktversagen. Damit ist nicht etwa ein marktliches Versagen der Medienunternehmen gemeint. In ihren Jahresergebnissen 2017 vermeldeten Bertelsmann, Europas größter Medienkonzern, ProSiebenSat.1 und Axel Springer Rekordgewinne. Die größten Zuwächse verzeichnete sie im Online-Geschäft, bei Springer um 12,5 Prozent. Gemeint ist eine Unterversorgung mit gesellschaftlich gewünschten Public Value Inhalten. Der Markt bietet vieles, aber er bietet auch vieles nicht, z.B. Reportagen, die ein kostspieliges Auslandskorrespondenten-Netzwerk erfordern, und Bildungs- und Kulturprogramme, die nur kleine Zuschauergruppen ansprechen. Der Schweizer Medienunternehmer Roger Schawinski war der SRG kurz vor der No-Billag Volksabstimmung mit einem Buch zur Seite gesprungen. Zentrale Aussagen: Die Werbeeinnahmen, die es für ein hochwertiges Informationsprogramm bräuchte, seien kaum zu erzielen. Abonnement-TV wiederum sei ökonomisch nur für Sport, Film und Pornos erfolgreich (NZZ 06.01.2018). Und selbst für eine kritische Sportberichterstattung ist zu erwarten, dass sie Sponsoreninteressen zum Opfer fällt.
Unstrittig ist der privatwirtschaftlich organisierte Journalismus ein ebenso wichtiger Teil der demokratischen Öffentlichkeit wie die ÖRM. Daher sind seine Schwierigkeiten, Erlösmodelle vor allem im Internet zu finden, ebenfalls ein Thema von gesellschaftlicher Bedeutung. Die Lösung kann jedoch nicht darin bestehen, den ÖRM Geld wegzunehmen oder ihnen eine Internet-adäquate Berichterstattung zu verbieten, um damit die Presse zu unterstützen.
Die meisten europäischen Länder fördern ihre Presse, entweder indirekt durch einen reduzierten Umsatzsteuersatz für Presseerzeugnisse wie in Deutschland oder direkt wie die österreichische Regulierungsbehörde KommAustria, die derzeit 8,9 Millionen Euro pro Jahr an Tages- und Wochenzeitungen vergibt. Zum Höhepunkt der Zeitungskrise, die 2002 mit dem Zusammenbruch des Anzeigenmarktes begann, mahnte Jürgen Habermas, dass sich keine Demokratie ein Marktversagen auf dem Pressesektor leisten könne. Bräche die Grundversorgung der Demokratie durch die Qualitätspresse weg, so werde der demokratische Staat selbst beschädigt. Daher sei es zwar kontraintuitiv, aber kein „Systemfehler“, wenn der Staat versuche, das öffentliche Gut der Qualitätspresse im Einzelfall zu schützen. Neben einmalige Subventionen für Presseunternehmen sieht er „Stiftungsmodelle mit öffentlicher Beteiligung oder Steuervergünstigungen für Familieneigentum in dieser Branche“ als geeignete Mittel.
Eine zukunftsfähige Medienfinanzierung muss die spezifischen Eigenrationaliäten von öffentlich beauftragten und kommerziellen Medien und ihre jeweiligen Gefahrenlagen berücksichtigen. Gesellschaftlich beauftragte Medien sind von der Gesellschaft zu finanzieren und in ihrer Auftragserfüllung zu kontrollieren. Eine Ergänzung durch Werbung und Sponsoring darf jedenfalls nicht zu einer Einflussnahme auf journalistisch-redaktionelle Entscheidungen führen. Statt dem Druck zu Systemgrenzen überschreitenden Allianzen mit Medienunternehmen nachzugeben, sollten sich die ÖRM öffnen für Partnerschaften mit anderen dem Gemeinwohl verpflichteten Akteuren im öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Sektor und mit ihren Nutzerinnen und Nutzern. Eine solche breite, öffentliche Allianz bietet die Chance, eine starke, europäische Präsenz im Netz aufzubauen.
Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org und Mitglied des RBB-Medienrates machte kürzlich einen interessanten Vorschlag: „Aus der Haushaltsabgabe könnten wir einfach mal zehn Prozent abziehen und in einen Fonds für nichtkommerzielle Netzinnovationen stecken. Damit könnten wir vielleicht das Facebook von morgen bauen, wo wir dann alle hingehen können, weil es datenschutzfreundlich, offen und sicher ist.“ (WDR Presseclub 08.04.2018) Öffentliches Geld in öffentliche Infrastruktur – das wäre ein Gebührensplitting, das die ÖRM nicht schwächt, sondern auf die nächste Stufe hebt und die Gesellschaft reicher macht.
Fragestellung 3: Digitalisierung und Demokratie
Die Digitalisierung – insbesondere der Erfolg sozialer Netzwerke und des Smartphones – verändert den gesellschaftlichen Diskurs und die mediale Öffentlichkeit rasant. Was kann zeitgemäße Medienpolitik zu sachlicher und unaufgeregter Kommunikation und Information beitragen?
Als oberstes Ziel von Medienpolitik ist uns von unserer Geschichte aufgetragen sicherzustellen, dass mediale Meinungsmacht nicht für Propaganda und Gleichschaltung missbraucht werden kann. Das wirksamste Mittel dazu ist es, die bestehenden Oasen der Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu erhalten und stärken. Das sind in erster Linie die ÖRM, aber auch andere öffentliche Wissensinstitutionen und zivilgesellschaftliche Wissensgemeinschaften.
Inhaltekontrolle im Netz
Ob über die orientierende Wirkung von Leuchtturmangeboten hinaus ein regulatorisches Eingreifen in öffentliche Kommunikation erforderlich und angemessen ist, steht derzeit zur Debatte. Digitale Medienpolitik, genauso wie digitales Medienmachen, erschließt Neuland. In beiden Fällen geht es nicht ohne Experimente. Deutschland hat mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ein solches Experiment gestartet, um rechtswidrige Äußerungen aus der öffentlichen Kommunikation zu beseitigen. Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken war im Bundestag umstritten und wurde heftig kritisiert, von einem breiten Bündnis aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft und nicht zuletzt von der EU (Wikipedia). Die Auswertung des in situ Experiments steht noch aus. Bislang wissen wir nur, dass bei der eigens eingerichteten Beschwerdestelle beim Bundesamt für Justiz in den ersten 100 Tagen nach Wirksamwerden des Gesetzes nur 253 Beschwerden eingingen. Die kommen von Internetnutzern, die rechtswidrige Posts in sozialen Netzwerken entdeckt und vergeblich versucht haben, die Plattform zu einer Löschung zu bewegen. Für diejenigen dagegen, die sich zu Unrecht gelöscht fühlen, ist die Behörde nicht zuständig (Spiegel 17.04.2018). Die niedrige Zahl von Beschwerden – der damalige Justizminister Heiko Maas hatte mit bis zu 25.000 im Jahr gerechnet – könnte darauf deuten, dass die Plattformen wie Facebook, das in Deutschland 1.200 Löschprüfer beschäftigt, fast alles richtig machen. Mehr werden wir wissen, wenn im Juli die ersten im NetzDG halbjährlich vorgeschriebenen Löschberichte der Plattformen für jedermann zugänglich im Internet veröffentlicht werden und diese wissenschaftlich, datenjournalistisch und zivilgesellschaftlich evaluiert sind. Dann wird auch das Ausmaß der erwarteten demokratieschädlichen Nebenwirkungen deutlicher werden.
Bis sich der ungewisse Ausgang des riskanten Experiments klärt, ist von einer Wiederholung z.B. in Österreich dringend abzuraten.